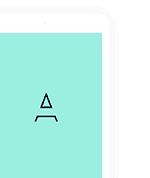Transcript
„dass man gar nicht Christ sein kann, ohne mit den Juden ins Gespräch zu kommen“ Manfred Görgs uneingeholte Vision des christlich-jüdischen Gesprächs Norbert Reck
Manfred Görgs in der Überschrift zitierte These ist von bestürzender Radikalität: Wenn es stimmt, dass die Vermeidung oder der Abbruch des Gesprächs mit den Juden Christen an einem genuinen Christsein hindert (von den christlichen Feindschaftserklärungen gegenüber Juden und Judentum ganz zu schweigen), dann wird man weite Zeiträume der „christlichen Geschichte“ mit Fragezeichen versehen müssen. Gewiss kann man diese These ablehnen, aber produktiver dürfte es sein, sich ihr auszusetzen, ihr zumindest ebensoviel Aufmerksamkeit zu schenken wie dem berühmten Wort Elie Wiesels, „dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist“1. Das soll hier versucht werden: eine Auseinandersetzung mit dem Gedanken Görgs von der Unmöglichkeit des Christseins ohne Gespräch mit den Juden. Geschehen soll dies – in aller gebotenen Kürze – auf dem Wege der Nachzeichnung seines Begründungsgangs, wie Görg ihn in seinem Essay In Abrahams Schoß2 entwickelt hat. Das Werk war bei seinem Erscheinen auf heftige Abwehr gestoßen; vor allem wohl wegen seines provokanten Untertitels Christsein ohne Neues 1
Zit. n. Robert McAfee Brown, Elie Wiesel. Zeuge für die Menschheit, Freiburg u.a. 1990, 184. Zu christlichtheologischen Auseinandersetzungen damit vgl. etwa Johann Baptist Metz, Auschwitz: Unverzichtbarer Ortstermin einer christlichen Gottesrede, in: Benedikt XVI., Wo war Gott? Die Rede in Auschwitz, Freiburg i. Br. 2006, 41–59; Rolf Rendtorff, Ist in Auschwitz das Christentum gestorben?, in: Reinhold Boschki – Dagmar Mensink (Hg.), Kultur allein ist nicht genug. Das Werk von Elie Wiesel – Herausforderung für Religion und Gesellschaft, Münster 1998, 168–180. 2 Manfred Görg, In Abrahams Schoß. Christsein ohne Neues Testament, Düsseldorf 1993. Zitate aus diesem Werk werden im Folgenden mit in Klammern gesetzten Seitenzahlen im Text angegeben. Die Schreibweise der Zitate wurde der heute gültigen Rechtschreibung angepasst.
Testament wurde es von vielen als „herausfordernd, ja verstörend“3 empfunden. Die Perspektiven, die es eröffnet, wurden damals kaum entdeckt und diskutiert. Darum sollen hier dessen biblische Grundlinien noch einmal skizziert und die theologischen Konsequenzen in den Blick genommen werden, um zuletzt die Konturen eines Gesprächs zwischen Juden und Christen zu umreißen, auf das Manfred Görg gehofft hat und das in seiner religiösen Tiefendimension bis heute kaum Wirklichkeit wurde.
Der Ausgangspunkt Dass der Dialog zwischen Juden und Christen etwas Erfreuliches sei, etwas Bereicherndes, dass er „nach Auschwitz“ in gewisser Weise für Christen auch moralisch geboten sei, trifft heute allenthalben auf Zustimmung, und gemeinhin werden die (wenigen) in diesen Dialogen engagierten Menschen mit freundlichen Worten bedacht und zuweilen auch mit Preisen ausgezeichnet. Darüber, dass das christlich-jüdische Gespräch – d.h. eine bestimmte Form dieses Gesprächs – für das Glaubensleben von Christen und Christinnen indessen unverzichtbar, ja theologisch unabdingbar sei, gibt es jedoch bislang keinen christlichen Konsens, und es meint in der Sichtweise von Manfred Görg wesentlich mehr als die Verwiesenheit des Christentums auf das Judentum, die nach Austausch verlange. Görg beginnt seine Reflexion mit der Beobachtung einer tiefen Verunsicherung der christlichen Identität in der Gegenwart (deren Wurzeln gleichwohl weit in die Geschichte des Christentums zurückreichen). Diese Verunsicherung zeigt sich in einer verbreiteten Ratlosigkeit, worin denn christliches Leben und Handeln heute bestehe, wie offen man Angehörigen anderer Religionen begegnen dürfe und wie man mit der Bandbreite divergierender innerchristlicher Positionen umgehen könne. Überspielt wird diese Unsicherheit mit gelegentlich starren Positionierungen in Fragen der Sexualmoral, mit der kaum verhohlenen Vorstellung vom Christentum als einer „Trans-Religion“ (12), die über den anderen Religionen stehe und über sie zu richten berechtigt sei4, sowie „zuweilen mit unerwarteter, ja unvorstellbarer Aggressivität in den eigenen Reihen“
3
Christoph Levin, Würdigung für Manfred Görg (1938–2012), in: MThZ 64 (2013/3), 210–213, hier 213. Neben Görg monieren das auch Angehörige anderer Religionen als Überheblichkeit, vgl. z.B. jüngst Lamya Kaddor – Michael Rubinstein, So fremd und doch so nah. Juden und Muslime in Deutschland, Ostfildern 2013, 99 und 4
(11). Als weitere Stichworte dieser Diagnose ließen sich anführen: der seit dem späten 18. Jahrhundert klaffende Graben zwischen historisch-kritischer Bibelwissenschaft und christlicher Dogmatik, insbesondere die Differenzen zwischen dem „historischen“ Jesus und dem kirchlich verkündeten Christus, die Auseinandersetzungen zwischen Traditionalisten und Modernisten, zwischen geschichtlichem und dogmatischem Denken, zwischen den Herausforderungen der Moderne und der Bewahrung des überlieferten Glaubens. Diese Gegensätze sind allesamt bis heute nicht wirklich überwunden oder aufgelöst, und sie haben dazu beigetragen, dass die Konturen des Christlichen undeutlich geworden sind und dass die Befähigung zum Bezeugen des christlichen Glaubens wie zum Gespräch mit Gläubigen anderer Religionen stark gelitten hat. Görgs Interesse besteht angesichts dieser allerorten greifbaren christlichen Identitätskrise nicht in einer umfassenden Ursachenforschung; sein Beitrag ist vielmehr der Hinweis auf eine allen genannten Phänomenen inhärente Tiefenstruktur, die in den Krisenanalysen der vergangenen Jahre so gut wie nie zur Sprache kommt: eben der Hinweis auf das immer wieder gestörte, vermiedene, verweigerte Gespräch zwischen Christen und Juden, Kirche und Israel. Zwar kam es nach der Schoa zu zahlreichen Dialoginitiativen, doch wird man kaum sagen können, dass jenseits theologischer Foren das jahrhundertealte Abgrenzungsdenken, die christliche Abwertung des Alten Testaments5 wie auch des Judentums bereits als überwunden gelten könnten. Auch nach vielen offiziellen kirchlichen Erklärungen und feierlichen Selbstverpflichtungen stehen Christen im katholischen Gottesdienst respektvoll auf, wenn das Evangelium vorgetragen wird, bleiben aber bei Lesungen aus dem Alten Testament sitzen – selbst wenn es sich dabei um Worte handelt, „die Israel seinen Gott sprechen lässt“ (13). So wird von Messe zu Messe die Minderbewertung des Alten Testaments performativ befestigt. Und trotz erstaunlicher Entwicklungen gerade auf dem Gebiet der Exegese des Alten Testaments findet man ansonsten bis heute in der Theologie Einlassungen, „die eine Zäsur zwischen dem ‚Alten‘ und dem ‚Neuen Testament‘ setzen mit der Behauptung, dass erst durch Christus die wahre Gottesbeziehung aufgedeckt passim. Zur Problemanzeige vgl. auch Gerhard Langer – Gregor Maria Hoff (Hg.), Der Ort des Jüdischen in der katholischen Theologie, Göttingen 2009. 5 Auch wenn heute verbreitet lieber von der „Hebräischen Bibel“ oder vom „Ersten Testament“ gesprochen wird, schließe ich mich dem Sprachgebrauch und der Einschätzung Görgs an, nach der etwas „Altes“ nicht unbedingt etwas „Überlebtes“ sein muss: „Vielmehr sollen wir bewusst machen, dass Alt-Sein viel mehr insinuiert, zum Beispiel das Ehrwürdig-Sein, das Früh-Sein, das Tradition-Haben. Wenn man vom Alter oder von einem alten Menschen spricht, dann muss man ihm nicht einen jungen Menschen gegenüberstellen. Das ‚Alte‘ hat seine ureigene Würde. Deswegen glaube ich nicht, dass man unbedingt von einem Anspruch auf ein neuformuliertes, alternatives Testament reden muss. Das gilt, obwohl oder gerade weil wir ein sogenanntes Neues Testament haben, denn das Neue Testament überholt das Alte nicht.“ (31f)
worden sei und das ‚Alte Testament‘ im Grunde in den Keller der Gläubigen gehöre, aber nicht auf den Tisch des Hauses.“ (15) In ihrem Verhältnis zum Alten Testament spiegelt sich die Haltung der Christen gegenüber den Juden. So war es lange Zeit üblich gewesen, das Alte Testament hauptsächlich auf vermeintliche „Ankündigungen“ des Kommens Christi hin zu lesen und damit zugleich den Juden vorzuwerfen, sie verstünden ihre eigene Heilige Schrift nicht, wenn sie diese Prophezeiungen nicht zur Kenntnis nähmen. Als nach der Schoa diese Denkfigur unmöglich geworden war, wurde der Weg für eine breitere Würdigung des Alten Testaments geebnet: Das Alte Testament sei ja, so heißt es seither vielfach, die Heilige Schrift Jesu, der sie als Jude, der er war, kannte und auslegte und daraus lebte. Deshalb müssten auch Christen sich um das Alte Testament bemühen. Das war gewiss ein Fortschritt, blieb aber weiterhin einer christologischen Engführung verhaftet, die zu einer Lektüre unter Vorbehalt führt – unter dem Vorbehalt nämlich, „dass das Alte Testament nur deswegen Gültigkeit habe, weil es vom Neuen Testament und Jesus rezipiert worden sei“ (41). Für Görg ist das als Begründung keineswegs hinreichend oder sogar inakzeptabel, weil darin ebenfalls eine subtile Minderbewertung des Alten Testaments (und eigentlich auch Jesu) liegt: Man lässt sich auf diese Schriften nur ein, weil sie „dem Herrn“ eben heilig seien – von sich aus würde man dies eher nicht tun. Görg geht demgegenüber entschieden weiter. Das Alte Testament und seine Inhalte können für sich selbst sprechen, sie brauchen keine formelle Würdigung als „Heilige Schrift Jesu“: „Es geht darum, direkt auf den Wortlaut und den Inhalt zu schauen, um zu erkennen, dass es sich hier um Einsichten in das Verhältnis des Menschen zu Gott, menschlicher Gemeinschaften zu Gott handelt, die unmittelbar für uns relevant sind. Ich möchte von einer direkten Einredequalität des ‚Alten Testaments‘ in unsere christliche Gemeinschaft reden dürfen.“ (14) Mit anderen Worten: Die alttestamentlichen Schriften sind nicht bloß religionsgeschichtlich bedeutsam, sondern vor allem auch in religiöser und theologischer Hinsicht. Gläubige Menschen können darin Erkenntnisse über Gott und das menschliche Leben entdecken, die sie in ihrer Suche und ihrem Glaubensleben begleiten und bestärken können. Und für die christlichen Kirchen, ihr Selbstverständnis und ihr Weltverhältnis hätte das Alte Testament wichtige Impulse zu geben. Aber so weit ist es noch nicht. Weder das Gespräch mit der Bibel Israels noch mit dem Volk Israel der Gegenwart hat Formen gefunden, die zu einem leidenschaftlichen Austausch über das Leben und Zusammenleben der Menschen führen könnten. Von christlicher „Seite“ aus deshalb,
weil es bis heute keine tragende Einsicht darüber gibt, „was Christen an das Judentum bindet“ (13). Anstelle einer solchen Einsicht herrschen weiterhin Abgrenzungsbedürfnisse und Besorgtheiten um „das unterscheidend Christliche“ – mit den bereits angesprochenen fatalen Konsequenzen für die christliche Identität. Wer glaubt, seine Identität auf dem Wege von Grenzziehungen erlangen zu müssen, läuft Gefahr, gerade das auszugrenzen, was den Kern der eigenen Identität bilden müsste. Dies zu erläutern ist die Absicht von Görgs Projekt „Christsein ohne Neues Testament“.
„Christsein ohne Neues Testament“ Um den Eigenwert des Alten Testaments auch für Christen erlebbar zu machen, fragt Manfred Görg danach, wie die ersten Jesus-Anhänger ihre Welt und die Taten und Worte Jesu erlebt haben mussten. Ein Neues Testament gab es noch lange nicht, man lebte damals gewissermaßen ein „Christsein ohne Neues Testament“ – im Referenz- und Anspielungsraum der Heiligen Schriften Israels. Alle zentralen Begriffe, mit denen die Gestalt und das Wirken Jesu gedeutet werden konnten, stammten aus diesen Schriften, allen voran die Reden vom Messias, vom Sohn Gottes und vom Menschensohn. Diese waren im jüdischen Bewusstsein präsent, sie dienten dem Verständnis der Wirklichkeit und kanalisierten die Erwartungen der Zukunft. Von ihnen her wurden dann auch die Erlebnisse mit Jesus von Nazaret gedeutet – die Blicke gingen also von den Schriften Israels hin zu Jesus, nicht umgekehrt. Um die entsprechenden frühen Diskurse über Jesus verstehen zu können – d.h. um zu verstehen, was in den Uranfängen des Christentums überhaupt verhandelt wurde, was in Jesus gesehen wurde, worum es beim „Glauben“ an Jesus eigentlich ging –, müssen folglich all diese Prädikate in ihrem Bedeutungshorizont erfasst werden, den sie im alttestamentlichen Diskursraum in verschiedenen Entwicklungsstufen erlangt haben. Eine solche Analyse der im Diskurs befindlichen Begriffe dient dabei nicht nur der Vermeidung von Anachronismen und undifferenzierten Vermengungen mit griechischen Vorstellungen, sondern bietet zugleich auch einen Ausweg aus den Sackgassen der Forschungen nach dem „histori-
schen Jesus“.6 Anstatt sich in Spekulationen darüber zu verlieren, was Jesus „wirklich“ gesagt oder getan hat, ist mit der Frage nach den Diskursen der Menschen zur Zeit Jesu ein wesentlich festerer Boden zu gewinnen.7 Nicht der unlösbare Streit darüber, ob Jesus sich wirklich als Messias sah, ist dann von Interesse, sondern die Frage, was dessen Anhänger mit diesem Prädikat zum Ausdruck brachten, auf welche Traditionen sie Bezug nahmen und wie sie sich damit in ihrer eigenen Zeit positionierten. Anders gesagt: Es sind die Diskurse und nicht so sehr die historischen Fakten, die uns helfen zu verstehen, worum es den ersten Jesusanhängern ging und was ihre Identität ausmachte. Görg will also den Christen der Gegenwart mitnichten die Lektüre des Neuen Testaments ausreden („Natürlich kann es keine Kirchen ohne Neues Testament geben“, 10); es geht ihm vielmehr darum, ihnen zu einem Blick auf Jesus von Nazaret zu verhelfen, der demjenigen der Zeitgenossen Jesu etwas näher kommt – zu einem Blick nämlich, der eben nicht von den späteren theologischen Kategorien des Neuen Testaments vorgeprägt wurde, sondern sich von der Tradition der Heiligen Schriften Israels leiten ließ.8 Nur das meint Görg mit dem Gedankenexperiment, die Geschichte Jesu einmal „ohne Neues Testament“ zu betrachten. Zeigen will er, wie viel von dem, was gemeinhin für typisch neutestamentlich oder christlich gehalten wird, bereits im Alten Testament auffindbar ist. Und umgekehrt will er für eine erneute Lektüre des Neuen Testaments den Blick schärfen, wie viele Motive dort aus dem Alten Testament stammen, die ihrer Herkunft entsprechend gelesen werden müssen. Tragendes Ziel bei diesem Unternehmen ist das grundlegende Interesse, deutlich zu machen, wie organisch Judentum und Christentum in ihrem Denken und ihren Schlüsselbegriffen verbunden sind und wie künstlich und ahnungslos die Versuche einer
6
Vgl. hierzu in jüngerer Zeit Klaus Wengst, Der wirkliche Jesus? Eine Streitschrift über die historisch wenig ergiebige und theologisch sinnlose Suche nach dem „historischen“ Jesus, Stuttgart 2013. 7 Gegenüber den Mutmaßungen über historische Fakten betont Michel Foucault die Positivität der Diskurse (vgl. ders., Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 81992, 92); Landwehr formuliert treffend: „Die Aussagen, die gemacht wurden, sind gemacht worden, und die Dinge, die gesagt wurden, sind gesagt worden – dieser Umstand allein ist schon ausreichend für die Begründung und den Gegenstand der Analyse“ (Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse, Frankfurt am Main 2008, 70). Görg hat den Diskursbegriff nicht gebraucht; er wird hier eingeführt, um eine wissenschaftstheoretische Fluchtlinie der Arbeit Görgs anzudeuten und auf wichtige Kompatibilitäten hinzuweisen. 8 Nicht zu verwechseln ist dieses Projekt mit dem Unterfangen von Hermann Samuel Reimarus, die „Lehren Jesu“ von denjenigen der Apostel abzuheben (vgl. Gotthold Ephraim Lessing [Hg.], Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger. Noch ein Fragment des Wolfenbüttelschen Ungenannten, Braunschweig 1778, 8). Auch neuere Versuche in dieser Richtung sind keineswegs mit Görgs Projekt verwandt, vgl. etwa Albert Nolan, Jesus vor dem Christentum. Das Evangelium der Befreiung, Luzern 1993, oder Ludger Schenke, Jesus vor dem Dogma. Zur inneren Überzeugungskraft der Worte Jesu, Stuttgart 2014.
Trennung von Altem und Neuem Testament sind – von Markion über die „Deutschen Christen“ bis hinein in unsere Gegenwart. Görg führt dieses Programm durch anhand der Begriffe des Bundes, des Messianismus, des Sohnes Gottes, des Menschensohns sowie anhand des Eigennamens Jesus. Welche Perspektiven das eröffnet, soll im Folgenden stellvertretend am Beispiel des Messianismus gezeigt werden.
Die Messiaserwartung: Entstehung und Weite Manfred Görg erläutert den Bedeutungsumfang des Messiastitels mit einem Blick auf verschiedene Phasen seiner Entwicklung. Ist der Titel des „Gesalbten JHWHs“ anfänglich eine königliche Würdebezeichnung (herrührend von der Salbung der Hände des Königs als einem kultischen Rechtsakt, die eine Kraftübertragung symbolisierte), in deren Folge die aramäische Wortbildung Maschiach in königsfreundlichen Texten immer wieder Verwendung findet (vgl. etwa die Psalmen 2, 18, 20, 89, 132), so drückt sich in königskritischeren Texten alsbald die Erfahrung aus, „dass zwischen dem Titel ‚Gesalbter‘ und dem persönlichen Träger eine Differenz bestehen kann“ (121). In dieser Differenz, d.h. „in der Erfahrung der konkreten Ausübung des zeitgenössischen Machtstrebens in Israel“ (122), sieht Görg den Ort der Entstehung des Messianismus als einer Utopie, die den real existierenden Königen ein Idealbild entgegensetzt: eine herrscherliche Gestalt, die Macht und Weisheit miteinander in Einklang bringt, sich durch Gerechtigkeit vor Gott auszeichnet und sich allen selbstsüchtigen Machtgebarens enthält. In der Folge entwickelt sich Maschiach zum Titel einer Hoffnungsgestalt, anhand deren das Ungenügen der wirklichen Herrscher kritisiert und die Ausrichtung auf eine bessere Zukunft formuliert werden kann. Dabei wird dieser Anspruch so weit gefasst, dass auch der Perserkönig Kyrus für eine gewisse Zeit als einer der Messiasse Gottes fungieren kann (vgl. 149). In der Zeit nach dem babylonischen Exil geht der Messiastitel vom König auf den Hohen Priester Israels über. Nach dem Verlust der staatlichen Eigenständigkeit verfolgen damit priesterschriftliche Autoren die Absicht, dem Kult im sich formierenden Judentum einen theokratischen Anstrich zu geben, wonach der oberste Kultdiener als hakkohen hammaschiach die Gegenwart Gottes auch in seiner Person deutlich macht. Der Hohe Priester tritt so als Hoffnungsträger in Erscheinung,
„der ganz anders und glaubwürdiger von der Präsenz Gottes auf Erden künden kann, als es die irdischen Machthaber in der vorexilischen Zeit tun konnten“ (124). Zugleich aber kommt anhand irdischer Unzulänglichkeiten der Repräsentanten des Göttlichen erneut die Erwartung auf, „es möchte doch jemand kommen, der wirklich glaubwürdig den Titel des Gesalbten verdient und der im Gesalbtsein seine besondere Beauftragung durch JHWH bezeugt, der für Israel zugleich eine Friedensperiode einleitet“ (125). Untrennbar verbunden ist der Messiastitel dabei mit der Bezeichnung „Sohn Gottes“. Psalm 2 etwa, einer der sogenannten Königspsalmen, spricht vom gesalbten König und bedient sich ägyptischer Phraseologie, wenn er ihn zugleich als einen „Sohn“ Gottes auftreten lässt, auf dem die göttliche Gnade ruht und der die Feinde zu bezwingen imstande ist. Versuche mancher Dogmatiker, die Sohn-Gottes-Titulatur und die Messiasvorstellung grundsätzlich voneinander zu trennen, hält Görg für „ganz hilflos und irreführend“, da beide gleichermaßen an den Anbruch einer kommenden Heilszeit geknüpft sind. „Es lässt sich keine Ablösung der Sohn-Gottes-Idee von der Messias-Konzeption konstruieren, wenn man nicht biblischen und außerbiblischen Befunden widerstreiten will.“ (126) Immer deutlicher wird dabei, dass die ersehnte Heilszeit kaum noch von einem irdischen Potentaten in Messiasfunktion ins Werk gesetzt werden kann, sondern dass es dabei um eine weit umfassendere Reform der ganzen Welt gehen muss, um eine Neuschöpfung, in der schließlich der Wolf beim Lamm wohnen wird (Jes 11,6) und die nur zuwege gebracht werden kann von einem ganz anders vorzustellenden Messias, von einem gerechten Friedenskönig, der mächtig, aber frei von allem Machtgebaren auf einem Eselsfohlen in Jerusalem einreitet (Sach 9,9). „Er muss von Gott mit Macht ausgestattet sein, wenn er auch äußerlich mit der Niedrigkeit verbunden ist. Er zielt hinein in die Gemeinde der Demütigen, das sind im Alten und im Neuen Testament die sogenannten ‚Armen‘ (hebr. cAnawim), die dann in Mt 21 zu der Begleitung des einziehenden Jesus in Jerusalem gehören.“ (147) So entwickelt sich ein Messianismus, dessen Bezugspunkt die c
Anawim sind und der auf umfassende Gerechtigkeit ausgerichtet ist, mit universalem, die ganze
Welt veränderndem, apokalyptischem Anspruch. Mit Blick auf die frühe jesuanische Gemeinde ist schon nach dieser knappen Auswahl der alttestamentlichen Motive mit Händen zu greifen, wie tief und weitgehend Jesus von seinen Zeitgenossen im Horizont messianischer Erwartungen gesehen und gedeutet wird. „Die frühjüdische Erwartung zur Zeit Jesu war gedrängt voll von messianischem Interesse“ (128), und das ist auch
später in den Evangelientexten nicht verwischt worden. Zahlreiche Fragen zielen präzise auf die alttestamentlichen messianischen Prädikate: „Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“ (Mt 11,3), „Bist du der Messias, der Sohn Gottes?“ (Mt 26,63), „Bist du der König der Juden?“ (Mk 15,2), „Du bist also der Sohn Gottes“ (Lk 22,70), „Wenn du der Messias bist, sag es uns offen!“ (Joh 10,24) u.v.m. Allem Anschein nach distanziert sich Jesus von diesen Erwartungen nicht, zeigt sich aber selbst ebenso stark von der frühjüdisch-apokalyptischen Naherwartung geprägt; er beansprucht keineswegs, dass alle messianischen Hoffnungen sich in seiner Person erfüllen werden, sondern teilt die Erwartungen auf ein weltveränderndes Kommen des Menschensohnes (wobei unentscheidbar bleibt, ob er sich mit diesem identifiziert oder nicht), auf eine bevorstehende große Umwälzung von Gott her. Tatsächlich gehen ja auch die aus den Heiligen Schriften Israels genährten Hoffnungen in ihrer Konkretheit weit über das hinaus, was Jesus selbst in der Welt bewirken konnte; „seine Tätigkeit erschöpfte sich zunächst im Binnenraum Israels, und er erschien als der Anwalt der Armen“ (157). Mit Blick auf die messianischen Hoffnungen wird man also mit Recht von einer „Erfüllung im Ausstand“ (119) reden dürfen, und jeder theologische Versuch zu behaupten, in Jesus sei bereits alles erreicht, wird zum Verrat gerade an dieser Spannung auf das noch ausstehende (Wieder-)Kommen des Menschensohnes, an dieser Spannung auf die ausstehende Gerechtigkeit. Solche Theologie verkommt zu einer Art „Erfüllungsfetischismus“ (142), der die Parusie nicht wirklich ernst nimmt oder nur in der Lage ist, sie triumphalistisch zu deuten: als eine Art Bestätigung für die „Richtigkeit“ des christlichen Glaubens – gegenüber dem jüdischen Beharren auf einer umfassend gerechteren Welt. Er zerstört das, was gerade die christliche Identität ausmachen müsste. Demgegenüber besteht Görg auf dem biblischen Befund, der auch für die christliche Theologie bindend sein muss. So ist vom Alten Testament her grundsätzlich mit einer Mehrzahl messianischer Gestalten zu rechnen: „Geschichte und Dimensionen des Messiastitels nötigen nicht zu dem Bekenntnis, dass Jesus ‚der Messias‘ war, schon gar nicht ‚der Messias Israels‘9, wohl aber bleibt
9
Görg wendet sich hiermit gegen die Formulierung im Beschluss der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland von 1980: „Wir bekennen uns zu Jesus Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist und die Völker mit dem Volk Gottes verbindet“ („Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“, Text unter: www.ekir.de/www/service/CAD70EA82F914247ADD2A66514220ECA.php). Trotz aller bedeutenden Fortschritte im Blick auf das christlich-jüdische Verhältnis in diesem Dokument kritisiert Görg am Ausdruck
es dem Anhänger Jesu unbenommen, ihn als einen ‚Messias‘ in Israel und im Frühjudentum anzusprechen, d.h. also als einen ‚Gesalbten‘ in der Traditionslinie der ‚Gesalbten‘.“ (152) Blickt man von diesen Traditionslinien aus auf Jesus – wie es zweifellos die ursprünglichen Anhänger Jesu tun –, dann wird relativ unkompliziert sichtbar, worum es der Jesusbewegung geht: um den Anbruch einer Zeit der Gerechtigkeit und des Friedens, um Gerechtigkeit insbesondere für die Armen, chronisch Kranken, Behinderten und Ausgestoßenen. Nicht um individuelles Seelenheil (so individuell dachte man einfach nicht) und nicht um den Glauben an ein Leben nach dem Tod (das wurde ohnehin längst mehrheitlich geglaubt). Man glaubt, dass in Jesus das ersehnte Gottesreich der Gerechtigkeit endlich begonnen hat – wenn es auch noch lange nicht vollendet ist. Mit anderen Worten: Blendet man die Horizonte, mit denen das Alte Testament die Gestalt Jesu versieht, nicht aus, dann erschließt sich auch, was christliches Handeln und christliche Identität damals wie heute ausmachen sollte: das Mitwirken am Reich der Gerechtigkeit, die Nachfolge Jesu in seinem Einsatz für die Armen und Verachteten.10 Hieran muss sich christliche Identität entfalten, und zugleich gibt es hierin keine Distanz zur Weltsicht des religiösen Judentums: „Das neue Jerusalem, die heilige Stadt (vgl. Offb 21,2–4) ist das Ziel, zu dem die gesamte Menschheit unterwegs ist.“11 Das bedeutet im Übrigen nicht, Christen müssten darum auf ihren Glauben verzichten, dass Jesus auch der kommende Menschensohn sei – solange die jesuanische Ausrichtung auf die Gerechtigkeit nicht jenem theologischen Erfüllungsfetischismus geopfert wird, der nichts mehr von der diesseitigen Welt erwartet: „Ich meine schon, dass man diesen noch kommenden Jesus in seiner endzeitlichen Retterfunktion [...] für den Messias halten sollte, der die alttestamentlichen Erwartungen in ihrer absoluten Breite auf sich zieht, der mit dem historischen Jesus in einer geheimnisvollen Liaison steht.“ (119) So ist es in dieser Perspektive gerade das, was über den – wie auch immer konstruierten – „historischen Jesus“ hinausweist, nämlich „die Vorstellung vom Wiederkommenden“ (128), die nicht Distanz, sondern Nähe zum Judentum schafft, in dem Bewusstsein, dass die Erfüllung der größe„Messias Israels“, dass hier ein christlicher Suprematieanspruch in der Deutung der Geschichte gegenüber Israel fortlebt. 10 In jüngster Zeit rückt Papst Franziskus hier einiges gerade, vgl. z.B. sein Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium: „Wenn zum Beispiel ein Pfarrer während des liturgischen Jahres zehnmal über die Enthaltsamkeit und nur zwei- oder dreimal über die Liebe oder über die Gerechtigkeit spricht, entsteht ein Missverhältnis, durch das die Tugenden, die in den Schatten gestellt werden, genau diejenigen sind, die in der Predigt und in der Katechese mehr vorkommen müssten.“ (Nr. 38) 11 Ebd., Nr. 71.
ren Hoffnungen noch aussteht: „Ich denke, dass Christen und Juden unendlich viel mehr verbindet, als wir bis jetzt in unserem Bewusstsein wahrhaben wollen, nämlich die Wiederkunft des Menschensohnes. Das heißt doch nichts anderes als die Anerkenntnis einer neu zu schaffenden Welt, eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wie sie Juden erwarten und Christen ebenso dicht und eindringlich erwarten sollten.“ (162) Die Christen sind somit keineswegs die exklusiven Besitzer der Messiashoffnung; vielmehr teilen sie die Erwartung einer besseren Zukunft mit den Juden. Und sie könnten und sollten die Erwartungen der Juden ebenso wie die des Alten Testaments in ihre Hoffnung mit aufnehmen: um ihren Blick zu schärfen und ihre Leidenschaft zu befeuern, um ihre Identität zu erneuern und gesprächsfähiger zu werden. „Wir verstehen auf diese Weise, wie eng Christen an die Juden geknüpft sind, dass man gar nicht Christ sein kann, ohne mit den Juden ins Gespräch zu kommen und dass die Aufnahme der jüdischen Erwartung ein substantieller Bestandteil dessen ist, was Christen erwarten.“ (128)12
In Abrahams Schoß Was heißt „mit den Juden ins Gespräch kommen“? Sicher nicht, bei jeder aufkommenden Glaubensfrage Juden als Auskunftspersonen und Experten anzugehen. Die Juden der Gegenwart haben gewiss anderes zu tun, als Christen bei ihren Identitätsproblemen auf die Sprünge zu helfen. Es ist zunächst an etwas Umfassenderes zu denken, an eine neue Geisteshaltung, die Christen lernen sollten: Im Bewusstsein, dass Juden und Christen ein Gutteil ihrer Heiligen Schriften gemeinsam haben, hieße „Im-Gespräch-Sein“ erstens, dass Christen auf jene Schriften hören, die sie Altes Testament und die die Juden Tanach nennen – anstatt sie als unwesentlich abzutun oder zur bloßen „Vorstufe“ zu erklären. Das Alte Testament muss in die christliche Theologie hineinreden dürfen. Dazu gehört zweitens, zur Kenntnis zu nehmen, dass es für die gemeinsamen 12
Unter den neueren Arbeiten in dieser Richtung sind hervorzuheben: Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der christlichen Bibel, Gütersloh 2011; Hubert Frankemölle, Das Evangelium des Neuen Testaments als Evangelium aus den heiligen Schriften der Juden, Münster 2013; Paul Petzel, Christ sein im Angesicht der Juden. Zu Fragen einer Theologie nach Auschwitz, Münster 2008; Klaus Wengst, Jesus zwischen Juden und Christen: Re-Visionen im Verhältnis der Kirche zu Israel, Stuttgart 22004. Eine knappe, präzise Übersicht der theologischen Ansätze bietet Hans Hermann Henrix, Schweigen im Angesicht Israels? Zum Ort des Jüdischen in der ökumenischen Theologie, in: Langer/Hoff (Hg.), Der Ort des Jüdischen in der katholischen Theologie, aaO., 264–297.
Schriften zum Teil erheblich divergierende Auslegungen gibt. Wer das Alte Testament wirklich besser verstehen und daraus die theologischen Konsequenzen ziehen möchte, wird sich dafür interessieren, wie die jüdischen Deutungen der entsprechenden Texte aus dem Tanach lauten. Und drittens: „Im-Gespräch-Sein“ heißt wahrnehmen, dass „die Juden“ keine historische Kategorie sind, sondern auch unsere Zeitgenossen, die zu vielen Fragen, die Christen wichtig sind, eigene Anschauungen aus ihrer bis heute lebendigen Tradition haben. Diese Anschauungen sollten Christen interessieren – wenn Juden sie teilen möchten –, ohne Anbiederung und Vereinnahmungsversuche. Görg kommt in diesem Zusammenhang auf das alte Bild eines Zusammenfindens „in Abrahams Schoß“ zu sprechen. Die „abrahamische Ökumene“ ist bekanntlich nicht unumstritten13, doch ist für Görgs Ansatz wesentlich, dass er die unterschiedlichen Bezüge von Juden und Christen (sowie Muslimen) zu Abraham nicht einebnet und eine künstliche Symmetrie der Verhältnisse herzustellen versucht. Er bezieht sich vornehmlich auf die Rede JHWHs im Buch Genesis, in der es u.a. heißt: „Und es sprach JHWH zu Abram: Geh weg aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen [...] Und durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen.“ (Gen 12,1–3) Görg vermutet, dass in dieser Passage „eine Alternative zum herrschenden Machtpotenzial der Regierenden, eine Alternative zum Königtum Salomos und seiner Nachfolger zur Sprache kommt“ (169). Damit wäre Abra(ha)m nicht nur die Paradefigur eines „Glaubensgehorsams“, sondern auch der Protagonist eines Glaubens, der sich gegenüber dem menschlichen Herrschaftswillen kritisch für Schlichtheit und Beweglichkeit entscheidet. In der jüdischen Tradition gilt die Abstammung von Abraham für alle seine Nachkommen als „Rechtfertigung“ vor Gott – auch ohne eigene Verdienste, allein aufgrund von Abrahams Glauben. Dies hält Görg fest gegenüber jenen Christen, die nicht verstanden haben, dass es die Nachkommen Abrahams nicht nötig haben, „erst durch Jesus zur Rechtfertigung geführt zu werden“ (174). Für alle anderen – und Görg nennt hier explizit Christen und Muslime – gälte die Zusage des Textes, dass „alle Geschlechter der Erde“ ebenfalls durch Abraham Segen erlangen können, wenn sie sich ehrend auf ihn beziehen. 13
Zu den verschiedenen Positionen vgl. Pim Valkenberg, Hat das Konzept der „abrahamitischen Religionen“ Zukunft?, in: Concilium 41 (2005/5), 553–561; Henning Theißen, In Abrahams Schoß? Die rheinische Landessynode beschließt eine neue Arbeitshilfe zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen, in: Kirche und Israel 24 (2009/1), 4–12; Edna Brocke, Aus Abrahams Schoß? Oder weshalb es keine „abrahamitischen Religionen“ gibt, in: Kirche und Israel 24 (2009/2), 157–162.
Damit wäre eine Perspektive gegeben, in der alle Menschen – nicht durch den Bezug zum Christentum oder zu Christus, sondern durch den Bezug zu Abraham – auf den Segen Gottes hoffen dürfen. In diesem Sinne ist das Sein „in Abrahams Schoß“ ein gemeinsames Sein vor Gott, ohne dass die Einen den Anderen eine fehlende „Rechtfertigung“ oder einen fehlenden Segen vorhalten müssten. Das nun wäre in Görgs Augen erst die wirkliche Grundlage für ein Im-GesprächSein, in welchem Christen die Juden nicht mehr als bloße Auskunftspersonen benutzen und sich Christen und Juden auch nicht in einem dürren „So machen wir es – so macht ihr es“ so vieler Dialogveranstaltungen verlieren. In einem solchen Gespräch müsste es vielmehr nicht um die Einen oder um die Anderen gehen, sondern um etwas Drittes: um den Zustand dieser Welt im messianischen Prozess, um die Bedingungen für Gerechtigkeit und Frieden, um die Beendigung der Armut und der Ausbeutung, um die wirksame Kontrolle der Mächtigen dieser Erde. Erst dies wäre ein Gespräch, in welchem nicht die Einen durch die Bereicherung ihres Glaubensverständnisses belohnt würden, während die Anderen ihre Geduld mit einer Mehrheitskultur strapazieren müssten. Es wäre ein Gespräch, in dem die Sensibilität, Leidenschaft und Kreativität aller Beteiligten gleichermaßen gefragt wäre – geschärft von den heiligen Schriften, den jeweiligen Auslegungstraditionen und den gewalterfüllten geschichtlichen Erfahrungen –, denn es ginge um etwas Gemeinsames: die Zukunft dieser Erde vor dem Angesicht Gottes.
Erschienen in: Stefan Jakob Wimmer und Georg Gafus (Hgg.), "Vom Leben umfangen" – Ägypten, das Alte Testament und das Gespräch der Religionen. Gedenkschrift für Manfred Görg (Ägypten und Altes Testament 80), Ugarit-Verlag, Münster 2014