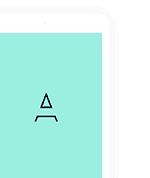Transcript
| 41 Peter O. Büttner Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
Dieser Beitrag stellt drei Thesen zum vormodernen Elementarschreibunterricht vor, dessen kulturhistorische Erörterung bis heute ein Forschungsdesiderat darstellt. Das verbindende Moment dieser Thesen ist ihr Bezug zum disparaten Schreibdiskurs, wie er die pädagogische Debatte ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belebte. Bis etwa 1750 dominierten professionelle Kalligraphen in Europa das Feld der Schönschreibkunst. Als jedoch die Schreibkunst für Schule und Haus unerlässlich wurde und der Bürger nach einfachen und machbaren Schreibschriften verlangte, geriet die exklusive Stellung der Kalligraphen ins Wanken. Ihre Kunst wurde von eifrigen Pädagogen und Schulmännern vom Sockel gestoßen und durch anwendbarere Schreiblehren und Schriften nachhaltig verdrängt. Dieser Aspekt berührt die sich über ein halbes Jahrhundert hinziehende Krisis der Schreibkunst und ihre Auflösung um 1800.
These 1: Die Rolle des Schreibdidaktikers war im 18. Jahrhundert noch unbesetzt Noch im 18. Jahrhundert war der Schreibunterricht in seiner didaktischen Ausrichtung wenig innovativ und kindgerecht. Er orientierte sich prinzipiell an den strengen Vorgaben der Kalligraphen der Frühneuzeit. Gegen Ende des Jahrhunderts kam es unter Schreibmeistern und Pädagogen, was Methodik, Effizienz und Schriftarten betrifft, zu Kompetenzansprüchen und gegenseitiger Beeinflussung. Doch erst um 1800 gewannen die Pädagogen gegenüber den Schreibmeistern die Oberhand und erreichten, dass die ursprüngliche Meisterlehre zum allgemeinen Schulfach wurde – eine kulturelle Revolution mit langfristigen Folgen: die Alphabetisierung Europas wurde nicht allein durch die Schulpflicht eingeleitet, sondern durch einen veränderten Schreibunterricht und durch vereinfachte Schul- und Schreibschriften. Dieses Verlangen nach schriftlichem Ausdruck ist der sozialen und ökonomischen Aufbruchsstimmung des erwachenden Bürgertums in den Städten Europas geschuldet. Hieraus erwuchs der Anspruch auf Bildung. Dieser Umstand war es, der zur Gründung privater Schreib- und Rechenschulen führte, die untereinander
|
42
Peter O. Büttner
und mit den Lateinschulen konkurrierten (Heisinger 1927, 4). Die Schreibmeister lehrten ihre Schüler komplizierte Schriftstücke und Formulare aufzusetzen, zu gliedern und zu formulieren. Wohl auch aus diesem Grunde sannen Schreibmeister auf immer differenziertere Schriftarten, um Kunden anzulocken und andere Werkstätten auszustechen (Brod 1968, 9). So wurde die Qualität der Kalligraphie auch zu einem Wettbewerbsfaktor, denn die Schulmeister lebten von ihrer Schreibtätigkeit und von ihrem Schreibunterricht und waren dementsprechend auf zahlungsfähige Kundschaft angewiesen (Ludwig 2005, 269 f.). Schreibmeister führten nicht nur eigene Schreibschulen, sondern hatten daneben „oft Funktionen wie die eines Ratsschreibers oder eines Kanzlisten an einem Fürstenhof“ inne (Frenz 2006, 101). Ihr sozialer Rang war durch Vermögen, Wohnort und Bildung bestimmt (Wienker-Piepho 2000, 78). Die besten Schreibmeister, auch Modisten oder Calligraphici genannt, waren nicht nur Lehrer, sondern oft auch Künstler und unterhielten ihre Schulen in großen Handelsstädten, wo Kaufleute, Handwerker und Bürger nach ihrer Kunst verlangten.1 Diese Schreibmeister versuchten nicht bloß schön und regelmäßig zu schreiben, sondern auch ihre Schrift durch allerlei Farben, Verzierungen und Sonderbarkeiten hervorzuheben. Heute ist kaum mehr bekannt, dass die Nürnberger Modisten zuerst die Kleinschreiberei erfanden. Ihre Buchstaben waren so zierlichklein geschrieben, dass man diese ohne Vergrößerungsglas kaum lesen konnte (Nick 1858, 85 f.). Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden neue Schriftformen, die für fürstliche Kanzleien sowie für Rats- und Handelsherren repräsentativ wurden. Rechts- und Geschäftsdokumente verlangten nach wie vor eine individuelle Gestaltung, die bis ins 19. Jahrhundert weiterhin den Händen professioneller Schreiber anvertraut blieb (Sprenger 1998, 8 f.). Schreibmeister beherrschten und lehrten neben den gewöhnlichen Kurrentschriften auch die kunstvollen Versalien, die oft als Initialen verwendet wurden. Solche Kunstschriften dienten vorwiegend nicht zur Mitteilung von Inhalten, sondern als Bühne für den unerhörten Erfindungs- und Formenreichtum des Meisters (Frenz 1999, 147 f.) Für Otto Ludwig sind damit zwei entscheidende Richtungen markant: „In der einen kam es auf die Vielfalt an Schriften an, in der anderen auf die Virtuosität ihrer Ausführung. In der einen standen die gelehrte Kenntnis und das handwerkliche Können im Vordergrund, in der anderen die Kunstfertigkeit des Kalligraphen. Der ersten Richtung gehören die Anfänge, der zweiten die Zukunft.“ (Ludwig 2005, 270)
Schreibmeister waren Verfasser vielseitiger Lehr- und Musterbücher, die auf die Ansprüche, Wünsche und Begierden ihrer Käufer zielten. So kunstvoll sich ihre 1 Bevorzugt wurden im 15. und 16. Jahrhundert wie auch in die folgenden, verkehrsreiche Gegenden der Stadt, besonders die Umgebung von Gasthäusern (Heisinger 1927, 22).
Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
| 43
Bücher heute ausnehmen, waren sie doch allein für den Alltag hergestellt. Diesen Büchern – zumindest was ihr Erscheinen in den ersten 200 Jahren betrifft – ist „ihr Bezug zum Schreiben als Handwerk und ihre Verbindung zur Schreibpraxis der Kanzleien der Territorialstaaten“ eigen (Ziessow 1991, 128). Kalligraphen konzipierten ihre Werke als Ratgeberliteratur, indem sie sich mit „Zirkel und Richtscheit, mit arithmetischen Tafeln und Weltkugeln“ (Ziessow 1991, 128) selbstbewusst darstellten. Damit war diese Zunft lange Zeit autonom, mächtig und herausragend. In ihren Lehren legten sie die Normen und die Richtung fest, wie geschrieben werden sollte, und stifteten sowohl Zugehörigkeiten als auch Abhängigkeiten. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verlor die Monopolstellung der Schreibmeister zunehmend an Bedeutung. So wurde das ehemals zunftgebundene Handwerk zu einer attraktiven Berufsperspektive auch für Angehörige der Mittelund Unterschicht (Ziessow 1991, 128). Diese Schreiblehrer, die am Verkauf ihrer Schriften interessiert waren, ließen sich auf die bildungskonformen Aspekte ein und verfassten vermehrt auch kindgerechte Schreiblehren für den privaten und öffentlichen Schulunterricht. So war der Weg geebnet, einen Schreibunterricht aller zu fordern und durchzusetzen, was die Alphabetisierung in Europa erheblich förderte. In methodischer Hinsicht knüpften sie alle jedoch an die Schreibtradition des 16. Jahrhunderts an, indem sie die in den Schulen angewandte Methode kritisierten, die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge zu lehren und auf das altbewährte Verfahren der Elementarisierung zurückgriffen, das ein Charakteristikum aller frühneuzeitlichen Schreiblehren war (Doede 1957, 16.) Hatten Kalligraphen des 16. Jahrhunderts diese Methode vorwiegend aus schreibästhetischen Gründen eingeführt, indem sie die einzelnen Buchstabenelemente nach den möglichen Bewegungslinien einteilten, so argumentierte man im 18. Jahrhundert didaktisch: Die Kinder sollten so möglichst zügig die Komplexität der einzelnen Buchstaben begreifen und mit Hilfe dieser Methode das Schönschreiben erlernen. Diejenigen Schreibmeisterbücher, die überhaupt eine Zerstreuung angeboten haben, hätten sich, so die These von Thomas Frenz, bereits auf einer gehobenen pädagogischen Ebene befunden. „In der Regel dürften die Verhältnisse viel primitiver gewesen sein: schon, dass noch im 19. Jahrhundert gegen die Praxis polemisiert wird, die Schüler die Buchstaben in der alphabetischen Reihenfolge lernen zu lassen, muss uns bedenklich stimmen.“ (Frenz 1999, 148)
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts versuchte man diese Methode weiter zu systematisieren und das Schreiben durch geometrische Vorübungen und mathematische Analysen auf Kosten opulenter Verzierungen für Kinder erlernbar zu machen. Man entdeckte die Beschreibungsmodelle der Renaissancekunst wieder, die in die Schreiblehren des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts einflossen. Auch
|
44
Peter O. Büttner
Pestalozzi war ein glühender Anhänger solcher Vorübungen. Über die Vorstufe der Mess- und Zeichenkunst sollten die Schüler zur Schreibkunst gelangen und sich so ein Verhältnis für Maß und Proportionen antrainieren. Mittels Zerlegung, Beschreibung und Gruppierung der Buchstaben erhoffte man sich, das Schreiben für alle schneller begreifbar und erlernbar zu machen. In methodischer Hinsicht betraten Schreibmeister des ausgehenden 18. Jahrhunderts jedoch kaum Neuland. Noch um 1800 blieb die Schreibkunst in ihrer didaktischen Ausrichtung auffallend konservativ, was nicht zuletzt auch daran lag, dass sie auf kein nennenswertes Theoriegebäude aufbauen oder sich für innovative Erneuerungen erwärmen konnte. Erst die Schreiblehrer des 19. Jahrhunderts glaubten diesem Mangel Abhilfe leisten zu können: „Wie alle größeren Bibliotheken und Archive zeigen, hinterließen uns schon frühere Zeiten schöne Vermächtnisse an handschriftlichen Kunstwerken; ohne daß man diese jedoch zur Feststellung einer sicheren und gut anleitenden Theorie der Schönschreibkunst zu benützen verstanden hätte. Erst unserem Jahrhundert war es vorbehalten, die bisher zerstreuten Ideen zu sammeln, aus der Praxis eine Theorie zu bilden, und die Schönschreibung zur eigentlichen Kunst zu erheben.“ (Payer 1840, 1 f.)
Die Hinwendung von der artifiziellen Kalligraphie zur anwendbareren Schreibweise mobilisierte die Pädagogen, sich mit kindgerechten Lernprozessen zu befassen, was nicht ohne Einfluss auch auf die Schreibmeister blieb. Was wir seit dem 18. Jahrhundert erleben, ist ein Kulturkampf zwischen Kalligraphen und Pädagogen, die sich beide mit einem bestimmten Adressatenkreis identifizierten: die Schreibmeister, die die Kunstfertigkeit besaßen, repräsentative Schriften zu schaffen, mit dem Adel, die Pädagogen, die diese artifiziellen Schreibschriften für Schule und Selbststudium als ungeeignet kritisierten, mit dem Bürger. Erst im 19. Jahrhundert hat sich der Typus des didaktisch geprägten „Schreiblehrers“ herausgebildet, der beiden Ansprüchen in der „Schönschrift“ nachzukommen trachtete. Die Figur des Schreibmeisters löste sich in Folge bildungshistorischer Veränderungsprozesse allmählich auf und verschwand um 1830 endgültig von der Bildfläche, während die Bezeichnung „Kalligraphie“ für Lehrbücher weiterhin Gültigkeit hatte. Die vereinfachte Schönschrift ist somit nicht nur das Resultat einer ökonomischen, sondern auch einer kulturellen Revolution. Pädagogen waren als Lehrer an Schulen, in wohlhabenden Familien oder als Vorsteher von Erziehungsanstalten tätig und brachten es mitunter zu einem beträchtlichen Ansehen. Auch sie haben sich teilweise als Verfasser von je eigenen Schreiblehren hervorgetan, nutzten aber hauptsächlich die Gelegenheit, sich in ihren pädagogischen Traktaten zum Schreibenlernen in oft höchst skurrilem Duktus zu ergehen. Die Zergliederung der Buchstaben in ihre Elemente haben zwar auch sie übernommen, aber im Gegensatz zu den Schreibmeistern waren sie in ihrer Auseinandersetzung mit dem Schreibenlernen innovativ und experimentierfreudig,
Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
| 45
was nicht zuletzt ihrem ursprünglichen Ziel geschuldet war, aus einem Kind mittels natürlicher Erziehung einen vernünftigen und selbstdenkenden Menschen zu formen. Hierzu waren ihnen die abwegigsten und verwegensten Methoden gerade recht. Beeinflusst durch die Gedanken Jean-Jacques Rousseaus und John Lockes haben vor allem die Philanthropen versucht, dem Schreibunterricht eine didaktisch-spielerische Komponente abzugewinnen. So hielten sie es für vernünftiger, das Schreiben vor dem Lesen zu lehren, die Buchstabiermethode mittels technisch vertrackter Apparate angeblich zu vereinfachen oder den Zeichenunterricht, den die Philanthropen erst zum Schulfach machten, mit dem Schreibunterricht zu verknüpfen. Einer von ihnen hieß Christian Carl André (1763–1831), der in seinem Ersten Lehrbuch des Zeichnens, Schreibens, Lesens, Rechnens (1793/1797) diese Dinge sehr kritisch abwog und ihre Brauchbarkeit für die Lehrmethoden eruierte. Diese didaktischen Auffrischungen waren den Schreibmeistern im Grunde zuwider, weil sie befürchteten, dass der Schreibunterricht so zu verkommen drohe. Nur langsam und zögerlich konnten sich die Schreibmeister den einfallsreichen Ideen der Pädagogen öffnen. Hierzu ein konkretes Beispiel: Die Angewohnheit, sich zum Geradeschreiben mit Bleistift gezogener Linien zu bedienen, wurde von Schreibmeisten wie Johann Wilhelm Keßler (1758–1825) noch 1787 streng abgelehnt. Solche Hilfsmittel würden zu einer steifen, hölzernen, langsamen Schrift führen und einen „sehr furchtsamen und ungewissen Geradeschreiber“ bilden (Keßler 1787, 48). Diese von Keßler geäußerte Bemerkung hatte derselbe 1810 unter dem Einfluss pädagogischer „Vorarbeiten“ (Vgl. Keßler 1810, 107) jedoch wieder revidiert. Mit dem Vorschub der Pädagogen und ihrem Eingreifen in den Kompetenzbereich der Kalligraphen war die Schreibmeisterkunst in ihrer traditionellen Ausrichtung am Ende: „Der Meister wurde zum Lehrer und der Lehrling zum Schüler, die Meisterlehre zum Unterricht“ (Barfaut 1968, 11). Doch die Rolle des Schreibdidaktikers war im 18. Jahrhundert noch unbesetzt, sämtliche Lehr- und Kalligraphiebücher blieben in theoretischer und methodischer Aufmachung der frühneuzeitlichen Schreibtradition des 16. Jahrhunderts verpflichtet. Zu einer Synthese zwischen Schreibmeistern und Pädagogen kam es erst Anfang des 19. Jahrhunderts, als 1809 das Fundament der Schreibkunst des Pädagogen Karl August Zeller (1774–1840) auf dem Schreibpult der Kinder lag. So entstand aus einer zunächst eher losen Wechselwirkung beider Disziplinen nach 1800 ein intensiver Dialog, wie er am Beispiel der Schiefertafel gezeigt werden kann.
|
46
Peter O. Büttner
These 2: Die Einführung der Schiefertafel hatte nicht allein didaktische Gründe Engagiert, leidenschaftlich, ja geradezu kämpferisch haben Schreibmeister, Pädagogen und Schultheoretiker gewissermaßen ihre Schulhöfe verteidigt. Wohl am deutlichsten lässt sich die Meinungsverschiedenheit anhand der Schiefertafel-Debatte illustrieren, hinter der sich ein disparater Diskurs zwischen Schreibmeistern, Schultheoretikern und Pädagogen verbirgt, die aus ihren jeweils berufsgebundenen Perspektiven argumentierten: Schreibmeister verwarfen Kreide- und Schiefertafel aufgrund ihrer Unbrauchbarkeit für Schönschrift; Schultheoretiker wollten sie, weil Schreibpapier teuer war, aus ökonomischen Gründen in den Schulen eingeführt wissen, während Pädagogen in ihr eine neue Errungenschaft des simulierten Schreibens, der Selbstkorrektur und Charakterbildung erkannten. Schreibmaterialien waren für ärmere Bevölkerungsschichten noch Anfang des 19. Jahrhunderts kaum erschwinglich. Rudolph Steinmüller erwähnt in seiner Helvetischen Schulmeister-Bibliothek (1801), dass manche Eltern ihre Kinder mit Medizingläschen, Salbennäpfchen, Beckenscherben und ausgehöhlten Nussschalen anstelle von Tintengefäßen in die Schulen schickten (Steinmüller 1801, 45). Wegen der hohen Kosten der Schreibmaterialien lernten viele Kinder, besonders in den Dörfern, kaum schreiben. Deshalb oblag die Anschaffung der Schreibutensilien oft den Lehrern, während die Eltern für das teure Papier aufkommen mussten. Weil Papier infolge seiner aufwendigen Herstellung sehr teuer war, konnte in den Niederen Schulen nicht täglich geschrieben werden; zudem musste mit dem Papier sparsam umgegangen werden. Der hohe Papierverbrauch bei Schreibanfängern und die um 1800 ansteigende Nachfrage nach Schreibunterricht zwangen zur Einführung von Kreide- und Schiefertafeln, die durch Abwischen immer wieder verwendet werden konnten. So riefen Schultheoretiker dazu auf, die ersten Schreibübungen auf einer Tafel mit Kreide oder auf einer Schiefertafel mit Griffel schreiben zu lassen. Kreidetafeln wurden hauptsächlich für den ABC-, Erstlese- und Erstschreibunterricht verwendet, Schiefertafeln außerdem für den Rechtschreib- und Rechenunterricht. Heinrich Bosse meint, dass die Schiefertafel jedoch nicht wegen ihres „ökonomischen Überbaus“ (sic!), sondern aus didaktischen Gründen eingeführt wurde: „Die Schiefertafel ersetzt keineswegs den Schreibunterricht mit Feder, Tinte und Papier; sie ist ihm vorgeschaltet, um den Schreibunterricht zu verdoppeln“ (Bosse 1985, 193).2 Die Schreibmeister kümmerten solche didaktischen Belange wenig, sie behielten allein die Schreibkunst im Auge und sorgten sich um das Recht- und Schönschreiben. Sie kritisierten das Tafelschreiben als unbrauchbar und rieten von Anfang an 2 Bosse bezieht sich hier auf das (nicht erhaltengebliebene) Vorschriften- oder Griffelbuch Pestalozzis, das dieser für seine vier- bis fünfjährigen Leseschüler konzipiert hatte.
Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
| 47
zum Federschreiben. Kinder würden zwar beim Tafelschreiben die Grundstriche und Buchstaben lernen, aber nie das Federschreiben. Noch weniger hielten sie vom Kreideschreiben, weil durch die verkrampfte Griffhaltung des Kreidestücks der Umstieg zur Feder noch schwerer sein würde (Ulrici 1772, Bl. III). Zudem werde die Kreide schnell stumpf oder breche gar ab, was auch das Schönschreiben behindern würde. Johann Wilhelm Keßler fand, dass nur das Abschreiben mit der Feder zu einer schönen, leichten Handhaltung führen könne: „Noch schädlicher aber ist der Gebrauch der Kreide, des Blei- und des Schiefersteinstifts beim Schreibenlernen deswegen, weil sich die Kinder ein starkes Drücken angewöhnen, und dadurch den ersten Grund zu einer schweren und langsamen Hand legen. Auch die Angewöhnung des öftern Auslöschens, wenn ein Buchstabe nicht recht gerathen will, ist eine nachtheilige Folge des Kreiden- Schieferstein- und Hornschreibens.“ (Keßler 1787, X–XI)
Für den Schönschreibunterricht war besonders die Schiefertafel sicher wenig geeignet. Sie bestand aus einer dünnen, harten und schwarzen Schieferplatte, die in einem Holzrahmen eingefasst und zur Erleichterung im Schreiben und Rechnen jeweils mit Linien und Karos versehen war. Zum Schreiben selbst war ein aus feinstem Staube zusammengesetzter Schieferstein erforderlich. Dieser wurde gegen das Austrocknen in feuchten Kellern gelagert, anschließend wie Holz gespalten und durch Schaben oder Drechseln zu einem Griffel geformt. Durch Aufdrücken und Ziehen des Steingriffels auf der Schieferplatte entstand durch Materialabrieb eine scharfe Schreibspur. Dies machte die Schreibtafel auf Dauer rau und rissig, was dem Schriftbild nachteilig war; fließende Schreibbewegungen waren so kaum mehr möglich (Keßler 1787, X–XI). Der Zürcher Pädagoge Caspar David Hardmeyer sah die Dinge ganz anders: „Es gab zwar hier und da Leute, welche glaubten, die Hand des Kindes werde durch den Gebrauch des Griffels schwer. Mehrjährige Erfahrungen lehrten mich aber, daß die schwache Hand des vier- bis fünfjährigen Kindes, auf diese Weise, bald die nöthige Kraft bekommt, um den Formen der Buchstaben die gehörige Bestimmtheit zu geben.“ (Hardmeyer 1808, 66)
Johann Heinrich Rusterholz, seit 1803 Mitglied des Erziehungsrates in Zürich, beschreibt in seiner Anweisung zum fruchtbaren Unterricht im Schönschreiben (1809) wie die Schiefertafel im Anfangsunterricht gebraucht werden sollte: „Auf diese Schiefertafel schreiben die Anfänger mit einem Griffel (Steinkreide), der scharfeckig gefeilt wird, so daß seine Spitze die Breite eines Messerrückens bekommt, um die Grundstriche leicht und auf ein Mahl damit zu bilden. Der Lehrer gewöhnt den kleinen Schreibern gerade im Anfange, den Griffel zwischen die 3 ersten Finger zu legen, ihn mit Leichtigkeit in der gehörigen schiefen Lage zu führen, eben so, wie die
|
48
Peter O. Büttner Feder auf dem Papier geführt wird. Fehlerhaftes Halten des Griffels kündigt sich fast allemahl durch ein Gekirre auf der Schreibtafel an.“ (Rusterholz 1809, [1]–2)
Wie das Schreiben mit der Feder, so verlangte auch das Schreiben mit dem Griffel eine richtige Fingerhaltung. Hinzukommt, dass bei falscher Griffelführung ein durchdringendes schrilles Quietschen das Kind gleichsam alarmiert. Johann Heinrich Pestalozzi hat in seiner Schrift Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (1801) das persönlichkeitsformende Erziehungsmoment der Schiefertafel dargelegt, indem der Schüler gezwungen war, neben den schlechten auch immer wieder die gelungenen Linien auszulöschen. Das Hervorbringen und Löschen vollkommen guter Schriftzeichen stärkte das Selbstbewusstsein, übte aber gleichzeitig in Bescheidenheit: „Und endlich achte ich auch dieses für einen sehr wesentlichen Vortheil dieser Manier: das Kind löscht auf der Schiefertafel auch das vollkommen Gute immer wieder aus, und man glaubt nicht, wie wichtig es ist, daß dieses geschiehet, wenn man nicht überhaupt weis, wie wichtig es für das Menschengeschlecht ist, dass es anmaßungslos gebildet werde und nicht zu frühe dahin komme, dem Werk seiner Hände einen Eitelkeitswerth beyzulegen.“ (Pestalozzi 1801, 162)
Es ist paradox, so Heinrich Bosse, dass die „archivierende Praxis des Schreibens“ geradezu an einem „Anti-Archiv“ gelernt werden sollte. Die Übungen mit Kreide und Griffel würden ein „Spiel der An- und Abwesenheit“ eröffnen, sie seien im Grunde nichts anderes als Hilfen zum Erinnerungszwang, was Bosse wohl mit „Technik der Vergeistigung“ meint (Bosse 1985, 194). Aber gerade diese anti-archivierende Praxis des Schreibens auf der Schiefertafel war in den meisten Schulen vor 1800 noch nicht gegeben; man schrieb weiterhin auf Papier, dessen Herstellung aufwendig und teuer war. Erst nach 1800 setzte sich die Schiefertafel in den Schulen durch und blieb bis in die 1950er Jahre Standard. So lässt der Schreibdiskurs im deutschsprachigen Raum in Grundzügen die Krisis erahnen, in der sich die Schreibkunst zu jener Zeit befand, herbeigeführt durch differente Interessengruppen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen über den Stellenwert der Kalligraphie, ihrer Weitervermittlung oder Abwandlung in Richtung eines aktuellen Gebrauchswertes. Doch der Einfluss der Schreibmeister erstreckte sich nicht bloß auf die eigene Disziplin, sondern er tangierte auch den Leseunterricht.
Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
| 49
These 3: Der Schreibunterricht des 18. Jahrhunderts bremste die Weiterentwicklung des Leseunterrichts In den Elementarschulen wurde Lesen ausschließlich durch Buchstabieren gelernt. Angesichts dieser althergebrachten Unterrichtsform konnten Kinder erst nach vielen Jahren flüssig lesen. Der Grund, weshalb sich eine Schreiblesemethode oder die Lautiermethode in den Schulen nicht durchsetzte, hing mit dem immer wichtiger werdenden Rechtschreibunterricht zusammen, der sich konsequent an der traditionellen Buchstabiermethode abarbeitete, wie sie von Schreiblehrern verlangt wurde. So wurde der Leseunterricht in seiner Weiterentwicklung durch den Schreibunterricht gebremst. Erst die Ablösung dieser Methode fürs Schreibenlernen um 1830 förderte eine neue Lesedidaktik. Die Schulmeister privater oder öffentlicher Elementarschulen waren ursprünglich Schreiber, Notare oder Kopisten. Daher wurde im Mittelalter das Schreiben entweder vor oder gleichzeitig mit dem Lesen unterrichtet. Diese Verbindung des Schreibgeschäfts mit dem Schuldienst war nicht zufällig, sondern entsprang vielmehr aus der Beschaffenheit des mittelalterlichen Elementarunterrichts und war vor der Erfindung des Buchdruckes selbstverständlich gewesen (Kriegk 1871, S. 80–81). Die Schreiblesemethode, in Frankreich unter dem Begriff Scriptolégie oder Ecriture-lecture bekannt, wurde in Deutschland im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts rege diskutiert. So forderte der deutsche Pädagoge Ernst Christian Trapp 1780: „Ich würde […] das Schreibenlernen gleich von Anfang an mit dem Lesenlernen verbinden. Es scheint mir in mancher Hinsicht vortheilhaft, dis zu thun. Kinder, so wie Menschen überhaupt, mögen gern selbst etwas machen und gemacht haben. Man gönne ihnen also das Vergnügen, die Buchstaben und Silben, die man ihnen zeigt, gleich mit Kreide, Röthel oder Bleistift nachmalen zu dürfen. Sie werden zehnmal so geschwind die Buchstaben, das Lesen, und das orthographische Schreiben lernen.“ (Trapp 1780, 361)
Zu den Pionieren und Verfechtern dieser Methode wird auch der SchaumburgLippesche Konsistorialrat und Superintendent Carl Gottlieb Horstig (1763– 1835) gezählt (Göbelbecker 1933, 159). Unter der Überschrift: Wie soll der junge Bürger lesen und schreiben lernen? (1796) schreibt Horstig einleitend: „Wenn ich voraussetzen dürfte, daß jeder Leser so vollkommen, wie ich selbst, davon überzeugt wäre, daß das Schreiben künftig dem Bürger eben so nothwendig wie das Lesen seyn würde, so bedürfte es keiner weiteren Entschuldigung, warum ich das Lesen mit dem Schreiben verbunden wissen will.“ (Horstig 1796, 46)
Der Diskurs des Schreibleseunterrichts ist in der pädagogischen Literatur immer wieder anzutreffen. So erwähnt Christian Carl André in seinem Lehrbuch (1793),
|
50
Peter O. Büttner
dass der Hauptzweck seiner Schrift darin liegt, den Kindern zuerst schreiben und dann „mit und bey dem Schreiben“ lesen zu lehren (ebd., 19). Das Erlernen der Muttersprache erfolgt seiner Ansicht nach durch „sprechen hören“, „selbst sprechen lernen“ und „schreiben lernen“ (ebd., 13). Das Lesen hat in Andrés Modell keinen Vorrang, da es eine für Kinder „sehr unnatürliche Beschäftigung“ sei (ebd., 16); das war von André schon äußerst modern gedacht. Das Kind interagiere mit seiner Umwelt hörend und sprechend, nicht jedoch lesend: „Es wächst unter Menschen auf“, so der Pädagoge (ebd., 15). Da die beiden ersten Punkte natürlicher Art seien, bedürften sie nach André auch keinerlei Rechtfertigung. Gerechtfertigt hingegen müsste die Schreiblesemethode, weil Lehrer stets davon ausgehen, dass das Lesenlernen notwendigerweise dem Schreiben vorauszugehen habe (ebd., 13). André kritisiert vor allem die isolierte Abfolge beider Kulturtechniken wegen ihrer langwierigen Aneignung. Unter großen Anstrengungen würden die Kinder erst Fraktur lesen lernen, dann Kurrent schreiben: „D.h. sie lernen zuerst Gedrucktes lesen, welches man sie aber nicht zugleich schreiben lehren kann. Nachher lernen sie wieder besonders Schrift schreiben, wobey man sie aber sehr gut zugleich lesen lehren könnte“ (ebd., 13). In einer zeitgleich entstandenen Schrift hat André noch das Handschriftenlesen lateinischer Schreibschriften als Vorübung für den Schreibunterricht anempfohlen: „Eine andere Uebung, die noch nothweniger vor dem Schreibenlernen vorausgehen müßte, und doch gewöhnlich so sehr vernachlässigt, und dem bloßen Zufall und der Zeit überlassen wird, ist die Uebung im Lesen des Geschriebenen. Unsere Kinder fangen gewöhnlich an zu schreiben, ehe ihnen noch die Figuren der Buchstaben durch öfteres Anschauen bekannt geworden. Da unsere Kinder sich einmal mit einem dreyfachen Alphabet (dem gedruckten deutschen, dem geschriebenen deutschen und dem lateinischen) quälen müssen, und ihnen beym Lesen des Gedruckten ihnen beym Lesen des Geschriebenen wenig oder gar nicht zu Hülfe kommt – so scheint es am vernünftigsten, die Uebung im Lesen des Geschriebenen sogleich auf die Uebung im Lesen des Gedruckten folgen zu lassen, kurz sie auf jeden Fall eher zu treiben, als das Schreiben selbst, das unendlich leichter und besser von Statten gehen wird, wenn der Lehrling schon eine Fertigkeit, Geschriebenes zu lesen, besitzt, und die ihm vorher noch ganz unbekannten Schriftzüge nicht erst durch das Schreiben kennen lernen darf.“ (André 1793a, 111 f.)
Diese Position revidierte André in seinem pädagogischen Hauptwerk allerdings wieder und forderte konsequent einen Schreibleseunterricht. Alfred Messerli hat in seiner Studie Lesen und Schreiben 1700 bis 1900 dargelegt, dass in der Praxis das Lesen von Handschriften eine eigene schulische Disziplin ausmachte und in den niederen Schulen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz bis etwa 1830 eine wichtige Rolle spielte. Allerdings galt das Handschriftenlesen als schwierig, so dass es in der Regel nur von älteren Kindern, meist von Knaben, in eigens dafür vorgesehenen Schulstunden erlernt wurde (Messerli 2000, 236). Trotz grif-
Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
| 51
figer Argumente, den Elementarunterricht zu revolutionieren, lernten die Kinder in den Schulen noch im 19. Jahrhundert erst lesen, dann schreiben. Diese Unterrichtsabfolge wurde in den Lehrplänen deshalb beibehalten, weil besonders Schreiblehrer dafür argumentierten, dass nur ein vorgeschalteter Leseunterricht die Grundlage des Rechtschreibunterrichts bildete. Entscheidend ist hierbei, dass die Kinder durch Buchstabieren das Lesen und Rechtschreiben erlernten. Für den Leseunterricht hatte die mechanische Buchstabiermethode weitreichende Folgen: „Bis man ordentlich lesen konnte, dauerte es in den Grundschulen bis 1830 zwei bis vier Jahre“ (Messerli 2002, 321). Die Buchstabiermethode geriet unter Lesedidaktikern jedoch frühzeitig in Kritik, weil sie nicht nur die Sprach- und Leseentwicklung erheblich behindern würde, sondern auch die Lesegeschwindigkeit. In Böhmen beispielsweise rühmte man sich, dass die Kinder um 1800 ohne Buchstabieren lesen lernten. Der mechanischen Buchstabiermethode standen manche Pädagogen und Schulmänner nicht nur kritisch, sondern radikal ablehnend gegenüber. Der Direktor des Taubstummeninstituts in Leipzig, Samuel Heinicke, hielt es für nicht übertrieben, Buchstabieren in Zusammenhang mit Folter, Hexen- und Ketzerverbrennung zu bringen. In seiner Abhandlung Über das Buchstabiren und die Unmöglichkeit dadurch lesen zu lernen (1785) sinnierte er, ob das Buchstabieren nicht einfach abgeschafft werden könne, gleich wie man in einigen „aufgeklärten, sittlichen und christlichen Ländern“ die Todesstrafe abgeschafft hätte (Heinicke 1785, 15 f.). In seinen Augen sei Buchstabieren nicht nur „unnötig und unnütze, sondern auch ganz unbeschreiblich schädlich und überdies noch die allergrößte Thorheit, die mit keiner andern, welche Menschen seit dem Sündenfalle begingen, zu vergleichen ist.“ (ebd., 16)
Schreibdidaktiker hingegen blieben bei ihrer Meinung, dass die Methode des Buchstabierens die einzig wahre sei, Kindern das orthographisch korrekte Schrei ben beizubringen; so wurde das Buchstabieren zu einer Basis des Schreibunterrichts. Eine prominente Stimme unter den Befürwortern der alten Buchstabiermethode war der reformierte Pfarrer Johann Karl Friedrich Witting (1760–1824). In seinem vielbeachteten Praktischen Handbuch für Prediger (1797) verteidigt Witting die Buchstabiermethode. Einfache Regeln seien zwar das beste Mittel, würden aber zu schnell wieder in Vergessenheit geraten. Deshalb sei es unerlässlich, dass die Kinder „vollkommen buchstabieren lernen“. Und er fährt fort: „Es ist dazu auch nicht genug, daß sie in den Büchern buchstabieren, und sprachrichtig geschriebene Vorschriften nachschreiben, sondern es muß ihnen auch oft etwas diktiert werden“ (Witting 1797, 22). Der Sprachwissenschaftler Andreas Gardt sieht die Zusammenhänge so: „Der Leseunterricht bis hin zu Ickelsamer war von der Absicht geprägt, den Kindern vor allem das richtige Schreiben beizubringen. Dabei herrschte die Buchstabiermethode
|
52
Peter O. Büttner vor: Der Lehrer gab ein Wort vor, buchstabierte es, und die Schüler wiederholten […]. Was die Schüler dabei lernen, sind allerdings nicht die Laute, sondern die Bezeichnungen der Buchstaben. Besonders mühselig wurde das Verfahren dadurch, dass zunächst alle Buchstabennamen einzeln, darauf in Silben und erst, wenn die Schüler dies beherrschten, anhand vollständiger Wörter geübt wurden.“ (Gardt 1999, 59)
Die These, dass der frühneuzeitliche Leseunterricht nur didaktische Vorübung für das Schreiben war, halte ich in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Kinder bis um 1800 nur Lesen in den Schulen lernten, für kaum überzeugend. 1838 nimmt der Reformpädagoge Adolph Diesterweg (1790–1866) rückblickend auf die alte Unterrichtsweise Bezug und kritisiert: „Analog der Buchstabir- oder Nominalmethode beim Lesen, lehrte man durch Buchstabiren das Rechtschreiben, d.h. man richtete die Aufmerksamkeit des Schülers einzig und allein auf die sichtbaren Zeichen der Laute, und machte es ihm unmöglich, der obersten Regel der Rechtschreibung: Schreibe, was du hörst! zu folgen, weil er sich der gesprochenen Laute in ihrer Besonderheit und Verbundenheit und in ihrem Verhältniß zu den Buchstaben entweder gar nicht oder nur höchst dunkel und unklar bewußt wurde. Dadurch entstand denn die chaotische Verwirrung in den Köpfen der Schüler, welche es ihnen erst nach tausend Erinnerungen möglich machte, das von daß zu unterscheiden, und den ganzen Rechtschreibunterricht in eine sclavische, blinde Nachahmung des Tyrannen Schreibgebrauch verwandelte.“ (Diesterweg 1838, 369)
Verschiedene Aussagen aus Selbstzeugnissen belegen, dass das Lesenlernen durch Buchstabieren erfahrungsgemäß für Kinder beschwerlich, ja geradezu ermüdend war (Petrat 1979, 40 ff.). Sie gerieten hierdurch an die Grenze ihrer kindlichen Auffassungsgabe: „man plagte, marterte und hielt die Kinder viele Jahre damit auf“ (Braun 1774, 47). Dieser lange Prozess des Lesenlernens blieb progressiven Lesedidaktikern und Pädagogen nicht verborgen. Sie wussten um die Schwierigkeit der permanenten Motivation der Kinder. Georg Christian Raff (1748–1788) schlägt in seiner Naturgeschichte für Kinder (1781) deshalb vor, Buchstabierer anschließend mit schönen Bildern zu belohnen: „So oft das Kind lesen oder buchstabiren sol, bringe er [der Lehrer] das Buch mit, und sage ihm, wenn es seine Sache gut mache, solle es schöne Bilder sehen, einen Affen, einen schwarzen Menschen, eine Katze, wie sie eben eine Maus fange.“ (Raff 1781, [IV])
Obwohl auch Philanthropen – allen voran Campe und Basedow – die alte Buchstabiermethode verwarfen und zu neuen Methoden griffen, wurde in den Schulen, wie die Helvetische Schulumfrage von 1799 aufs Eindringlichste belegt, an der Buchstabiermethode festgehalten. Erst im 19. Jahrhundert wurde sie durch die Lautiermethode ersetzt (Göbelbecker 1933, 159). So haben wir es mit einer dyadischen Verstrickung von zwei unterschiedlichen Interessenbereichen zu tun:
Drei Thesen zum historischen Schreibunterricht
| 53
Die Lesedidaktik hatte den Anspruch, den Lernprozess durch neu geschaffene Instrumentarien zu verkürzen und das Lesen insgesamt zu verbessern und zu beschleunigen. Die Schreibdidaktik hingegen war auf eine gründliche Buchstabierund Leseausbildung zentriert. So konnte der Schreibunterricht hemmend auf den Leseunterricht wirken. Eine Schreiblesemethode, wie sie bereits aus dem Mittelalter bekannt war, wurde auch aus Gründen der Klassenführung und Disziplin an keiner Schule eingeführt, da nicht alle Kinder schreiben lernten. Quellen- und Literaturverzeichnis Quellen
André, C. C. (1793a): Der Pädagoge Oder compendiöse Bibliothek des für Eltern und Erzieher wissenswürdigsten über Menschen-Ausbildung. Heft I. und II. Gotha, Halle: Johann Jacob Gebauer. André, C. C. (1793): Erstes Lehrbuch des Zeichnens, Schreibens, Lesens, Rechnens, der französischen und Muttersprache. Zum Gebrauch für Lehrer der Kinder aus den gebildeteren Ständen. Mit 11 Kupfertafeln. Gotha, Halle: Johann Jacob Gebauer. Braun, H. (1774): Gedanken über die Erziehung und den öffentlichen Unterricht in Trivial- Real- und lateinischen Schulen. Nach den katholischen Schulverfassungen Oberdeutschlands. Ulm: [Johann Conrad Wohler]. Diesterweg, F. A. W. (1838): Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer. In Gemeinschaft mit Hentschel, Hill, Knebel, Knie, Lüben, Mager, Mädler und Prange. Neue Auflage in zwei Bänden. 1. Bd. Essen: Druck und Verlag von G. D. Bädeker. Hardmeyer, C. D. (1808): Ueber Schreibekunst und Schreibunterricht. Zürich: bey Heinrich Gessner. Heinicke, S. (1785): Metaphysik für Schulmeister und Plusmacher. Halle: im Verlag bey J. C. Hendel. Horstig, C. G. (1796): Anweisung für die Lehrer in den Bürgerschulen. Hannover: im Verlag bey den Gebrüdern Hahn. Keßler, J. W. (1787): Lehrbuch der Kunst schön u. geschwind zu schreiben. Heilbronn: in Commission der Eckebrechtischen Buchhandlung. Keßler, J. W. (1810): Vollständiges Lehrbuch der Schreibkunst, mit besonderer Anleitung zum Schönund Geschwindschreiben. Zweyte, durchaus umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 18 neuen, in Kupfer gestochenen Vorschriften. Heilbron/Rothenburg ob der Tauber: Johann Daniel Claß. Payer, J. (1840): Systematische Anleitung zur Kalligraphie nach ihrem ganzen Umfange. Nebst Angabe der bisher unbekannten oder geheim gehaltenen Vortheile bei der Verzierung mit Gold und Silber, und einem Anhange von dem amerikanischen Schnellschreib-Lehrsysteme. Für Lehrende und zum Selbstunterrichte. Mit zehn Kupfertafeln. Wien: im Verlage des Verfassers, und in Commission bei Tendler und Schaefer. Pestalozzi, J. H. (1801): Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten, in Briefen. Bern, Zürich: bey Heinrich Gessner. Raff, G. C. (1781): Naturgeschichte für Kinder. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Göttingen: bey Johann Christian Dieterich. Rusterholz, J. H. (1809): Anweisung zum fruchtbaren Unterricht im Schönschreiben auf die leichteste, kürzeste und wohlfeile Weise für die gemeinen Volksschulen. Neue vollständige Ausgabe. Zürich: Gedruckt bey Joh. Kaspar Näf. Steinmüller, J. R. (1801): Helvetische Schulmeister-Bibliothek. Bd. 1. St. Gallen. Trapp, E. C. (1780): Versuch einer Pädagogik. Berlin: bey Friedrich Nicolai. Ulrici, A. G. (1772): Vorschriften zum Schönschreiben für die Schulen in Schlesien. Glogau: Christian Friedrich Günther.
|
54
Peter O. Büttner
Witting, J. C. F. (1797): Praktisches Handbuch für Prediger. Des fünften Bandes zweiter Theil. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.
Literatur Barfaut, W. (1968): Der Schreibunterricht. Weinheim, Berlin: Beltz (Quellen zur Unterrichtslehre, 13). Bieger, A. (2010): Die Schulschriften im Kanton Thurgau. Amriswil: Schulmuseum Amriswil. Bosse, H. (1985): „Die Schüler müßen selbst schreiben lernen“ oder Die Einrichtung der Schiefertafel. In: Dietrich Boueke und Rolf Sanner (Hrsg.): Schreiben, Schreiben lernen. Rudolf Sanner zum 65. Geburtstag. Tübingen: Gunter Narr (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 249), 164–199. Brod, W. M. (1968): Fränkische Schreibmeister und Schriftkünstler. Würzburg: Freunde mainfränkischer Kunst und Geschichte (Mainfränkische Hefte, 51). Doede, W. (1957): Schön schreiben, eine Kunst. Johann Neudörffer und seine Schule im 16. und 17. Jh. München: Prestel (Bilder aus deutscher Vergangenheit, 6). Göbelbecker, L. F. (1933): Entwicklungsgeschichte des ersten Leseunterrichts von 1477 bis 1932. In quellenmäßiger Darstellung und theoretischer Beleuchtung. Kempten, Leipzig: Otto Nemnich Verlag. Heisinger, H. (1927): Die Schreib- und Rechenmeister des 17. und 18. Jahrhunderts in Nürnberg. Ein Beitrag zur Geschichte des Lehrstandes. Nürnberg: J. L. Stich. Frenz, T. (1999): Die Schriftbeschreibung in den Schreibmeisterbüchern. In: Peter Rück (Hrsg.): Methoden der Schriftbeschreibung. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag (Historische Hilfswissenschaften, 4), 141–150. Frenz, T. (2006): Die Beispieltexte in den Schreibmeisterbüchern. In: Gisela Brandt (Hrsg.): Historische Soziolinguistik des Deutschen. Stuttgart: Hans-Dieter Heinz (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, 436), 101–112. Kriegk, G. L. (1871): Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Nach urkundlichen Forschungen. Neue Folge. Nebst einem Anhang enthaltend ungedruckte Urkunden aus Frankfurtischen Archiven. 2 Bände. Bd. 1. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten & Löning . Ludwig, O. (2005): Geschichte des Schreibens. Von der Antike bis zum Buchdruck. Bd. 1. Berlin: de Gruyter. Messerli, A. (2002): Lesen und Schreiben 1700 bis 1900. Untersuchung zur Durchsetzung der Literalität in der Schweiz. Tübingen: Niemeyer (Reihe Germanistische Linguistik, 229). Nick, A. F. (1858): Die Schreibkunst. Kurze Geschichte der Schreibkunst und Methodik des Schreibunterrichts. Reutlingen: Rupp & Baur. Petrat, G. (1979): Schulunterricht. Seine Sozialgeschichte in Deutschland 1750 bis 1850. München: Ehrenwirth. Sprenger, K.-M. (1998): Zug um Zug. Die Schreibmeister und ihre Kunst vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Mainz: Gutenberg-Museum. Wienker-Piepho, S. (2000): „Je gelehrter, desto verkehrter“? Volkskundlich-Kulturgeschichtliches zur Schriftbeherrschung. Münster: Waxmann. Ziessow, K.-H. (1991): Schreibmeisterbücher des 16.–19. Jahrhunderts aus der Sammlung von Friedrich Soennecken. In: Karl-Heinz Ziessow und Utz Maas (Hrsg.): Hand-Schrift, Schreib-Werke. Schrift und Schreibkultur im Wandel in regionalen Beispielen des 18. bis 20. Jahrhunderts. Cloppenburg: Museumsdorf Cloppenburg (Materialien zur Volkskultur nordwestliches Niedersachsen, 16), 127–156.