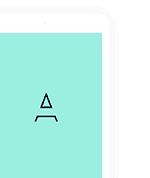Transcript
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Neurobiologie, Psychologie und die Frühprävention antisozialen Verhaltens: Eine ethische Vergleichsanalyse Dorothee Horstkötter und Guido de Wert1
Jugendkriminalität und Jugendgewalt werden als wichtige gesellschaftliche Probleme angesehen und ihrer Eindämmung wird große soziale und politische Bedeutung zugemessen. Auch wenn der öffentliche Ruf nach Strafe und Härte gegenüber jugendlichen Gewalttätern oft unüberhörbar ist, wird aus wissenschaftlicher Sicht vor allem auf die Bedeutung von Früherkennung und Frühprävention hingewiesen. Gegenwärtigen Trends in der Gesundheitspolitik folgend, lautet auch das neue Credo der Kriminologie: „Prävention ist besser als Sanktion“. Dabei scheint es nicht länger fraglich, ob Prävention sinnvoll ist, sondern welche Frühwarnsysteme und welche Interventionen effektiv sind. Die Identifizierung von Kindern, die sozialen und psychologischen Risikofaktoren ausgesetzt sind, spielt dabei genauso eine Rolle, wie Interventionsmaßnahmen, die diesen Entstehungsbedingungen von gewalttätigem und antisozialem Verhalten entgegen wirken sollen.2 Die Kinder- und Jugendpsychiatrie mit ihren diagnostizierbaren Verhaltensstörungen 1
Dieser Artikel basiert auf einer englischsprachigen Publikation zum gleichen Thema, die kürzlich in der
Zeitschrift BioSocieties erschienen ist (Horstkötter, Dorothee/Berghmans, Ron/de Wert, Guido (2014) Early prevention of antisocial behavior: A comparative ethical analysis of biomedical and psychosocial approaches, BioSocieties, Jg.9, H.1, S.60-83). Die hier vorliegende Überarbeitung berücksichtigt insbesondere auch die Situation in Deutschland. Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem im März 2013 verstorbenen Kollegen Ron Berghmans. Er hat zu der früheren Version dieses Beitrages maßgeblich beigetragen und war ein wertvoller Gesprächspartner in zahlreichen Diskussion, die wir über die hier behandelten Themen geführt haben. 2
Der Begriff des “antisozialen Verhaltens“ ist grundsätzlich schwer zu definieren. Er entstammt der Psychiatrie,
wird aber auch in juristisch relevanten Zusammenhängen verwendet. In diesem Artikel wird er weitgefasst und bezieht sich auf Verhaltensweisen, die anderen oder einem selbst erheblichen Schaden zufügen, wie Gewalt, Raub, Betrug oder Drogenmissbrauch und auf Persönlichkeitsstrukturen, die diese Verhaltensweisen begünstigen, wie etwa ein hohes Aggressionspotential, große Impulsivität oder ein geringes empathisches Vermögen. Dies entspricht weitgehend der diagnostischen Klassifikation „Störung des Sozialverhaltens“ der ICD-10, die darunter ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens versteht (WHO, 2004, F91) als auch der Klassifikation „conduct disorder“ [Verhaltensstörung] des DSM-5, die hiermit sich wiederholende und andauernde Verhaltensweisen bezeichnet,
1
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
(z.B. conduct disorder) rückt dabei zunehmend in den Vordergrund und die neuere wissenschaftliche Forschung weist zusätzlich auf biologische Aspekte hin. Die Ursachen von Jugendgewalt werden demnach auf individueller Ebene und im Bereich der Biomedizin gesucht. Genetische, neurobiologische und neurophysiologische Faktoren spielen für die Erklärung antisozialen Verhaltens eine wichtige Rolle (Fishbein, 2000, Hodgins u.a., 2009) und rufen teils weitreichende Erwartungen an die Ermöglichung präziserer Vorhersagen und effektiverer Interventionen hervor (Beauchaine u.a., 2008, van Goozen/Fairchild 2008). Im folgenden Beitrag wird die Bedeutung von Frühprävention als Strategie der Reduzierung antisozialen Verhaltens aus ethischer Sicht näher untersucht. Ausgangspunkt ist der bioethische Diskurs, der sich in den vergangen Jahren intensiv, und vielfach sehr kritisch, mit den ethischen, sozialen und juristischen Implikationen vor allem des biomedizinischen Ansatzes auseinander gesetzt hat (Wasserman/Wachbroit 2001; Nuffield Council on Bioethics 2002; Singh/Rose 2009; Horstkötter u.a. 2011). Diesem Ansatz gemäß kann antisoziales Verhalten insbesondere auch auf individueller Ebenen mittels genetischer, neurobiologischer oder physiologischer Faktoren erklärt werden. Kritiker haben diesbezüglich zahlreiche Bedenken herausgearbeitet und auf mögliche Fallstricke und Nachteile eines solchen Ansatzes hingewiesen. Während allerdings diesem Ansatz und möglichen zukünftigen hierauf basierenden Anwendungen viele Bedenken und umfangreiche Skepsis entgegengebracht wird, scheinen bestehende psychosoziale Frühpräventionspraktiken aus ethischer Sicht weitgehend unbeachtet geblieben zu sein. Dieser Beitrag wird sich vor allem mit dieser Diskrepanz im ethischen Diskurs auseinandersetzen. Bringt ein lebenswissenschaftlicher Ansatz tatsächlich mehr, schwerwiegendere oder ganz eigene ethische Probleme mit sich oder können stattdessen gegenwärtige psychosoziale Formen der Frühprävention nicht den gleichen oder ganz ähnlichen Bedenken ausgesetzt sein? Um dieser Frage nachzugehen, werden wir zuerst einen kurzen Überblick über die Grundprinzipien bestehender Frühpräventionspraktiken geben und danach die möglichen, derzeit angestrebten Anwendungen biomedizinischer Erkenntnisse besprechen. Im dritten Teil dieses Beitrages werden wir anhand vier ethisch relevanter Aspekte, nämlich der
bei denen die grundlegenden Rechte anderer missachtet oder gegen die wichtigsten alters-gemäßen Normen verstoßen wird (APA, 2013).
2
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Stigmatisierung, der negativen Identitätsentwicklung und Abweisung von Verantwortlichkeit, der sozialen Kontrolle und Überwachung sowie der Invasivität und Nebenwirkungen eine vergleichende ethische Analyse vornehmen.3 Dabei werden wir untersuchen, ob und inwieweit sich diese Probleme exklusiv für biomedizinisch begründete Formen der Frühprävention ergeben oder ob bestehende psychosoziale Projekte nicht die gleichen Fragen aufwerfen und eine eingehende ethische Untersuchung im gleichen Maße erforderlich ist.
1.
Grundprinzipien und Beispiele psychosozialer Frühprävention antisozialen
Verhaltens In den vergangen Jahren wurde eine Fülle von Präventionsprojekten entwickelt (Farrington/Coid 2003; Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2007) und in Evaluationsstudien sowie Metaanalysen und Reviews wird herausgestellt „what works“ (Farrington/Welsh 2007; Scheithauer u.a., 2012). Diesen Projekten liegt vielfach die Annahme zugrunde, dass psychologische und soziale Risikofaktoren, wie etwa ungünstige psychologische Bedingungen, eine problematische Herkunftsfamilie, das Aufwachsen in einer sozial-ökonomisch benachteiligten Gegend oder der Besuch einer Schule mit hohem Gewaltpotential, die Entstehung gewaltbereiten und antisozialen Verhaltens begünstigen (Farrington/Welsh, 2007). Präventionsprogramme versuchen, diesen Risiken gezielt entgegenzuwirken und deren Effekte abzumildern. Maßnahmen, die Kinder sehr früh in ihrer Entwicklung erreichen, werden dabei als wesentlich effektiver angesehen, als Programme, die erst im Schulalter oder während der Adoleszenz ansetzen. Die Bedeutung von Frühprävention wird also generell betont und sowohl international als auch in Deutschland besteht eine Vielzahl entsprechender Programme (Scheithauer u.a. 2012), deren Grundprinzipien im Folgenden aufgezeigt werden. Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen Frühwarnsystemen, die darauf abzielen, "Risikokinder" zu identifizieren und Interventionsmaßnahmen, die direkt oder indirekt antisoziales Verhalten verhindern oder reduzieren wollen. Universelle Programme richten sich an ganze Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel alle Kinder in einem 3
In diesem Beitrag setzen wir uns demnach vor allem mit Problemen und Nachteilen der vorgestellten Praktiken auseinander. Die möglichen Vorteile gehören dabei sicherlich auch zu einer umfassenden ethischen Auseinandersetzung, können an dieser Stelle allerdings nicht näher analysiert werden, so dass wir hier auf die einschlägige Literatur verweisen (AJK 2007; Farrington/Welsh 2007).
3
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
bestimmten Stadtteil oder einer bestimmten Schule. Selektive Prävention hingegen befasst sich individuell mit Kindern und Familien, die bereits auffällig geworden sind oder von denen angenommen wird, dass sie Gefahr laufen, auffällig zu werden. Zum Zwecke der Frühwarnung wurden zahlreiche Screeninginstrumente entwickelt. Der „Fragebogen zu Stärken und Schwächen“ (Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ, siehe, Goodman 1997) zum Beispiel ist ein universelles Instrument, mit dem strukturiert Informationen über das Verhalten, die Gefühle und die persönlichen Beziehungen von Kindern (ab 4 Jahren) und Jugendlichen gesammelt werden. Innerhalb eines breiten Ansatzes, enthält der Fragebogen auch gezielt Elemente, die es ermöglichen sollen, externalisierende, das heißt auf andere bezogene und schädigende, und antisoziale Verhaltensprobleme offenzulegen. Kinder, die auf dieser Grundlage auffallen, können danach selektiv intensiver untersucht werden. Dazu werden u.a. die viel spezifischeren Achenbach-Fragebögen (Child Behavior Checklist, siehe, Achenbach 1991) verwendet, die in einem umfangreichen Set von über 100 Fragen zum Beispiel auch danach fragen ob ein Kind ungehorsam ist (Frage 23), grausam und gemein Anderen gegenüber ist (Frage 16), sich häufig mit Anderen schlägt (Frage 37), oder sich unverantwortlich verhält (Frage 73). Auch die meisten Interventionen setzen entweder universell oder selektiv an. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht ist das Triple-P Program (Positive Parenting Programme), in dem auf verschiedenen Intensitätsebenen beide Ansätze kombiniert werden (Sanders u.a. 2002). Informationen über die natürliche Entwicklung kindlichen Verhaltens sollen dabei sehr viele Eltern erreichen; intensive familientherapeutische Maßnahmen hingegen sind Familien mit verhaltensgestörten Kindern vorbehalten. Die meisten Programme richten sich auf einen bestimmten Teilbereich, in dem relevante Risiken auftreten können. Für die jüngsten Kinder betrifft das vor allem das familiäre Umfeld. Prävention besteht dann hauptsächlich in der Betreuung und dem Coaching von (werdenden) Eltern, insbesondere alleinstehenden minderjährigen Müttern, deren Situation als risikobehaftet eingeschätzt wird (Farrington/Welsh 2007). Elterntrainings bestimmen auch die Prävention im Vorschulalter. Sie werden dann allerdings ergänzt durch gezielte kognitive Entwicklungsprogramme, welche die Kinder direkt ansprechen sollen oder durch Programme, die eine möglicherweise ungünstige Eltern-Kind Beziehung verbessern wollen (Tremblay/Japel 2003). Im Schulalter spielen zusätzlich Programme eine wichtige Rolle, die sich mit den Bedingungen an den Schulen auseinandersetzen und eine Verbesserung des 4
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Lernklimas, der Verbundenheit der Schüler untereinander und mit der Schule, sowie eine Steigerung der emotionalen und sozialen Fähigkeiten hervorrufen sollen (Hawkins/Herrenkohl 2003). Vielfach wird die Ausweitung, Verbesserung und wissenschaftliche Evaluation derartiger Maßnahmen gefordert. Dennoch kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass Frühwarnsysteme und früh ansetzende Gewaltpräventionsprogramme schon jetzt großen Einfluss haben, dass sich zahlreiche Fachkräfte aus verschiedenen Berufsgruppen hiermit befassen und dass viele Kinder, Jugendliche und Eltern einbezogen werden.
2.
Aussichten eines biomedizinischen Ansatzes Trotz jahrelanger und umfangreicher sozialwissenschaftlicher Forschung wird die
Effektivität bestehender Präventionsprogramme oft als eher gering eingeschätzt. In den letzten Jahren werden Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen der Biomedizin als mögliche Lösung vorgestellt. Ob und in wie weit diese Erkenntnisse aus rein wissenschaftlicher Sicht weitgehend anerkannt oder aber auch umstritten sind, kann an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden. Hier konzentrieren wir uns auf publizierte Erkenntnisse und die daran gestellten Erwartungen. Demnach sollen genetische, neurobiologische und neurophysiologische Faktoren dazu beitragen, individuell spezifische Risiken zu bestimmen und so einen Beitrag zur Entwicklung effektiverer Maßnahmen zu leisten. Diese sollen zudem auch Kinder und Jugendlichen erreichen können, die auf die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Methoden nicht oder nur unzureichend ansprechen (Beauchaine u.a. 2008, van Goozen/Fairchild 2008). Im Folgenden werden wir diesen Forschungsbereich kurz skizzieren und darlegen, welche möglichen Anwendungen die involvierten Wissenschaftler sehen und beabsichtigen. Wir sind uns dabei durchaus der Tatsache bewusst, dass zukünftige Entwicklungen weitreichender und einschneidender sein könnten. Allerdings ist das, was in der Theorie möglich erscheinen mag, oft auch spekulativ und gehört eher in den Bereich der Fiktion als der Wissenschaft. Aus ethischer Sicht interessieren uns vor allem realistische und vorhersehbare Probleme, so dass wir uns auf die tatsächlich intendierten Ziele beschränken wollen. Ein wichtiger Auslöser des biomedizinischen Ansatzes war wohl die Beobachtung, dass antisoziales Verhalten vielfach in denselben Familien aufzutreten scheint und 5
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
genetische Faktoren daher eine Rolle spielen könnten. Erblichkeitsstudien sollen den jeweiligen Anteil gemeinsamer genetischer Profile im Unterschied zu geteilten Umgebungsmerkmale bestimmen. Mit Hilfe von Zwillings- und Adoptionsstudien stellten Viding u.a. zum Beispiel heraus, dass geplantes und instrumentelles aggressives Verhalten oftmals genetischen Grundlagen zugeschrieben werden kann, wohingegen reaktives und spontanes aggressives Verhalten eher durch ungünstige Umgebungsfaktoren hervorgerufen wird (Viding u.a. 2009). In molekulargenetischen Studien wird beabsichtigt, Gensequenzen zu identifizieren, die bestimmte Neurotransmitter (fehl-) regulieren und so potentiell zur Entstehung als relevant erachteter mentaler Störungen beitragen. Ein Polymorphismus des MAOA-Genes ist dabei wohl das bekannteste und am häufigsten zitierte Beispiel. Träger einer kurzen Variante dieses Gens haben demnach ein erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens kriminell zu werden. Dieser Zusammenhang besteht allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Betroffenen in ihrer Kindheit schwere Misshandlung und Verwahrlosung erlitten hatten (McCrory u.a. 2012). Statt einfacher genetischer Veranlagungen erweisen sich komplexe Gen-Umgebungs-Interaktionen als die wahrscheinlicheren Erklärungsschemata. Was konkrete Anwendungen in der Praxis betrifft, wird vor allem auf die Möglichkeit der individuellen Differenzierung zwischen Untergruppen verhaltensauffälliger Kinder (instrumentelle versus reaktive Aggression) und der Entwicklung darauf zugeschnittener Präventionsmaßnahmen hingewiesen (Viding u.a. 2009). Dazu notwendige genetische Screenings könnten es überdies ermöglichen, genetisch anfällige Kinder zu identifizieren, und diese bei der Vergabe öffentlicher Jugendschutzmittel eventuell zu bevorzugen, wenn sie zusätzlich misshandelt werden (van Goozen/Fairchild 2008)4. Neurobiologische Studien versuchen Abweichungen in Gehirnstrukturen und funktionen bei Personen, die antisoziales Verhalten zeigen, zu erkennen. Hierbei spielen insbesondere Areale eine Rolle, von denen bekannt ist, dass sie bei der Regulierung von Emotionen, der Verarbeitung sozialer Informationen, dem zielgerichteten Handeln und der Selbstkontrolle beteiligt sind (Shirtcliff u.a. 2009). So wird instrumentelle Aggression vielfach in Verbindung gebracht mit einer geringen Aktivität des limbischen Systems und eine 4
Dabei gilt es natürlich auch zu beachten, dass eine Bevorzugung genetisch vulnerabler Kinder im
Umkehrschluss bedeuten könnte, dass misshandelte Kinder mit einem „günstigeren“ genetischen Profil eher sich selber überlassen würden und weniger Hilfe von außen erwarten könnten.
6
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
mangelnde Fähigkeit, spontane aggressive Reaktionen zu unterdrücken, wird korreliert mit Abweichungen im präfrontalen Cortex. Wiederum werden also Unterschiede in der Gehirnfunktion zum Anlass genommen, Untertypen antisozialen und aggressiven Verhaltens zu unterschieden. Etwas Ähnliches scheint auch im Bereich der Neurophysiologie zu gelten. Hier wird darauf hingewiesen, dass einige Kinder mit Verhaltensstörungen einen niedrigeren Herzschlag in Ruhe und einen geringen Hautwiderstand aufweisen (Ortiz/Raine 2004) und dass bestimmte Abweichungen des neuroendokrinologischen Systems Indikatoren für eine verminderte Stressreaktion sowie für die Unfähigkeit, Angst zu erfahren, sein können. Diese Kinder könnten deshalb dazu tendieren antisoziales Verhalten zu zeigen, da sie von möglichen negativen Konsequenzen kaum abgeschreckt (gestresst) werden. Hinsichtlich möglicher klinischer Implikationen dieser Erkenntnisse, steht wiederum die Differentialdiagnostik im Mittelpunkt: Kinder, die bei einer normalen physiologischen Stressreaktion antisoziales Verhalten zeigen, könnten, wie bisher, einer psychotherapeutischen Behandlung unterzogen werden. Kinder, die ein ganz ähnliches Verhalten zeigen, zudem allerdings eine untypische Stressregulierung haben und die auf gängige Behandlungsmethoden nicht oder kaum ansprechen, könnten zusätzlich, oder stattdessen, gezielt psychopharmakologisch behandelt werden (Frick/Petitclerc 2009). Darüber hinaus wird regelmäßig auch die Möglichkeit indirekter Einflussnahme auf die Gehirnfunktion hervorgehoben. Davon ausgehend, dass das Gehirn plastisch ist und neurobiologische Abweichungen vielfach die Folge ungünstiger Umgebungsbedingungen sind, wird der gezielten Anpassung und Verbesserung dieser Bedingungen auch aus neurobiologischer Hinsicht grundsätzlich große Bedeutung zugeschrieben. Das kann sowohl gezielt eingesetzte, womöglich individualisierte Erziehungsstrategien betreffen (Frick/Petitclerc 2009); aber auch auf die zuvor beschriebenen psychosozialen Projekte, wie die gezielte Vorschulförderung oder Elterntrainings, wird, zumindest gelegentlich, explizit hingewiesen (Viding u.a. 2009).
3.
Ethische Vergleichsanalyse
Biomedizinische Ansätze zur Erklärung normalen wie devianten menschlichen Verhaltens werden, seit ihrem erneuten Aufkommen vor etwa 40 Jahren, fortlaufend von skeptischen Kommentaren und kritischen Debatten begleitet. Hierbei werden bereits vor ihrer Erprobung und Anwendung deren mögliche ethische, soziale und juristische 7
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Implikationen aufgezeigt (Nuffield Council on Bioethics 2002; Parens u.a. 2006; Singh/Rose 2009). Auch wenn diese Debatte oft recht allgemein gehalten ist und konkrete Anwendungen wie die frühe Gewaltprävention nicht in ihrem Zentrum standen, sind die so herausgestellten Aspekte auch in dieser Hinsicht relevant. Dabei dürfte den folgenden vier Punkten eine Schlüsselrolle zukommen. Erstens wird befürchtet, dass Kinder, bei denen biologische Abweichungen festgestellt werden, besondere Gefahr laufen, von ihrer Umwelt abgestempelt, stigmatisiert oder diskriminiert zu werden. Zum Zweiten können biomedizinische Unterschiede als Zeichen besonderer Gefährlichkeit gedeutet werden, so dass Betroffene zunehmender sozialer Kontrolle, Unterdrückung und Ausgrenzung ausgesetzt werden. Der gleiche Gedankengang kann drittens dazu führen, dass die derart identifizierten Kinder selber eine entsprechende Identität, zum Beispiel die eines geborenen Kriminellen, entwickeln. Auch wird davor gewarnt, dass biomedizinische Erklärungsschemata die Übernahme persönlicher Verantwortung untergraben. Viertens wird darauf hingewiesen, dass gerade biomedizinisch begründete Screenings- wie Interventionsmaßnahmen nicht nur besonders invasiv sein können, sondern auch negative medizinische Nebenwirkungen mit sich bringen können. An dieser Stelle werden wir nicht näher auf die jeweilige Plausibilität und Dringlichkeit dieser Kritiken und Sorgen eingehen. Vielmehr interessiert uns die Frage, ob die etablierten und sozialwissenschaftlich begründeten Vorläufer früher Gewaltprävention prinzipiell nicht den gleichen ethischen Gefahren ausgesetzt sind (Freund/Lindner 2001; Burnett 2007). Was diese betrifft scheint immer noch zu gelten, was Gatti bereits vor Jahren bedauernd feststellte: Während „the efficacy of such [early] prevention programs has been thoroughly examined […] the ethical problems are generally ignored or hardly mentioned“ (1998: 113).
3.1.
Stigmatisierung und Diskriminierung Eine mögliche Herausstellung biomedizinischer Unterschiede zieht vielfach die Sorge
nach sich, dass die so identifizierten Risikokinder stigmatisiert und diskriminiert werden. Dem liegen sicherlich nicht nur allgemeine Sorge bezüglich des Stigmas zugrunde, mit dem zahlreiche psychiatrische Erkrankungen konfrontiert werden, sondern darüber hinaus auch die Annahme, dass biomedizinische Unterscheidungen die Betroffenen als grundsätzlich „anders-seiend“ darstellten (Rose 2000; Nuffield Council on Bioethics 2002). Ihr Risikostatus 8
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
und die Aussicht auf spätere Entwicklungspathologien könnten die Wahrnehmung von und den Umgang mit diesen Kindern stärker - und negativer - beeinflussen als deren tatsächliches Verhalten es eigentlich nahelegen würde. Kindergärten oder Schulen könnten ihnen den Zugang verwehren oder sie bewusst, oder unbewusst, bei Vorfällen innerhalb der Institution (zum Beispiel Streit, Diebstahl, Zerstörung) vorschnell verdächtigen, schuld zu sein. Allerdings kann dies allerdings nicht nur als Folge biomedizinisch angelegter Prognoseund Diagnosepraktiken auftreten. Auch die Herausstellung sozialer Risikofaktoren kann vergleichbar stigmatisierende Effekte haben. Implizit spiegeln sich derartige Sorgen auch in der Diskussion, inwieweit Interventionen universell oder selektiv angeboten werden sollten. Universellen Maßnahmen wird ein weniger stigmatisierender Effekt zugeschrieben als selektiven Programmen, die sich definitionsgemäß an zuvor identifizierte Risikogruppen wenden. Teilweise versuchen bestehende Programme dies zu beachten, wenn sie, wie das Triple-P Programm, ihre Angebote vielschichtig und für unterschiedlich breit gefasste Zielgruppen und in unterschiedlicher Intensität entwickeln. Ein derartiger Ansatz gilt dabei unter anderem als Schutzeinrichtung vor unnötiger Teilnahme an intensiveren Maßnahmen und eben auch der damit potentiell verbundenen Stigmatisierung. Gleichzeitig sehen aber gerade universell eingesetzte Programme sich dem Vorwurf ausgesetzt, ineffektiv zu sein, zu viele Personen unnötig einzubeziehen und die, bei denen eine Intervention Erfolg haben könnte, kaum zu erreichen. Das Problem möglicher Stigmatisierung wurde zwar auch für bestehende Programme erkannt. Es hatte aber offenbar kaum Konsequenzen. Zumindest stellt es keinen Grund dar, Frühpräventionsprogramme generell kritisch zu sehen, vor allem aber scheinen Untersuchungen zu fehlen, die der Frage nachgehen, ob die impliziten Schutzmechanismen überhaupt oder ausreichend greifen. Aus ethischer Sicht wäre es überdies notwendig, zu untersuchen, wie eine angemessene Abwägung zwischen den eventuellen Risiken von Stigmatisierung und Diskriminierung einerseits und der gewünschten Effektivität von Interventionsprogrammen anderseits aussehen sollte. Stigmatisierung und Diskriminierung sind keinesfalls exklusive Probleme möglicher zukünftiger biomedizinischer Präventionsprogramme. Sie bestehen potentiell genauso im Hier und Jetzt psychosozial begründeter Frühprävention.
3.2.
Negative Identitätsentwicklung und Abweisung von Verantwortlichkeit
9
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Kinder früh als Risikokinder zu identifizieren kann des Weiteren problematisch sein, wenn dies weitgehend negative Effekte auf die Selbstwahrnehmung und Identitätsentwicklung der betroffenen Kinder hat (Phelan 2005). Insofern biomedizinische, und insbesondere genetische Profile, als besonders stabil und nicht abänderbar wahrgenommen werden5, können Kinder, wie ihre Eltern, eine fatalistische Haltung entwickeln und sich als geborene Kriminelle sehen oder ein nur geringes Selbstwertgefühl entwickeln. Auch wird befürchtet, dass eine derartige Reduzierung des Verhaltens auf biomedizinische Grundlagen dazu führen kann, dass die Betroffenen sich als passive Opfer ihrer Gene oder Gehirne sehen und persönliche Verantwortung zurückweisen („Die Gene sind schuld“) (Levitt/Manson, 2007). Aber sind ähnliche Sorgen nicht gleichermaßen relevant bezüglich der Herausstellung von psychologischen und sozialen Risikofaktoren? Kinder, denen vermittelt wird, dass sie in einem sozial-ökonomisch benachteiligten Stadtteil aufwachsen, eine Schule besuchen, an der viel Gewalt herrscht oder aus einer Familie stammen, in der viel Streit herrscht und in die sich die Behörden regelmäßig einmischen, können sich daraufhin bewusst werden, dass andere sie vor allem in negativer Weise und als problematisch wahrnehmen. Dies wiederum kann für sie ein Anlass sein, sich „erst recht“ mit diesen Gegebenheiten zu identifizieren und eine damit übereinstimmende Identität zu entwickeln. Es ist daher zumindest fraglich, in wie weit es gerechtfertigt sein kann, biomedizinisch begründete Maßnahmen aus diesem Grund bereits im Vorhinein zu verurteilen, über ähnliche Probleme in anderen Bereichen allerdings hinwegzusehen. Dies impliziert nicht, dass Risikofaktoren generell nicht länger untersucht werden sollten. Wohl aber kann ein derartiger Prozess auch kontraproduktiv sein, so dass sowohl bei der Herausstellung biomedizinischer als auch psychosozialer Risiken die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden müssen. Auch was die mögliche Zurückweisung persönlicher Verantwortung betrifft, scheint der Unterschied zwischen biomedizinischen Aussichten und psychosozialen Realitäten geringer zu sein, als der bioethische Diskurs suggeriert. So werden schlechte Kindheitserfahrungen seit langem in Zusammenhang gebracht mit späterem kriminellem oder antisozialen Verhalten. Auch aufgrund schlechter Erfahrungen können Betroffene die
5
Ob sie das tatsächlich sind, kann an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden. Kritische Anmerkungen scheinen hier allerdings angebracht, wenn man zum Beispiel die Plastizität menschlicher Gehirne, epigenetische Effekte und die Bedeutung von Gen-Umgebungs-Interaktionen bedenkt.
10
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Verantwortung abschieben wollen: „Meine schlechte Kindheit ist schuld“. Die mögliche Zurückweisung persönlicher Verantwortung ist nicht zwingend ein exklusives Problem biomedizinischer Forschungsergebnisse, es stellt sich potentiell gleichermaßen im Zusammenhang mit althergebrachten Erkenntnissen über die möglichen Entstehungsbedingungen gewalttätigen Verhaltens. Statt derartige Konsequenzen als Anlass zu sehen, biomedizinische Forschung in diesem Bereich generell zurückzuweisen, scheint es sinnvoller a) zu untersuchen ob Betroffene tatsächlich so argumentieren und inwiefern eine solche Argumentation authentisch ist oder bloß instrumentell eingesetzt wird, zum Beispiel im Gerichtssaal zur Erreichung von Strafmilderung und b) eine philosophisch-konzeptuelle Diskussion einzubeziehen, die das Verhältnis komplexer Co-Determinanten menschlichen Verhaltens und der persönlichen Verantwortung für dieses Verhalten klären kann.
3.3.
Soziale Kontrolle, Überwachung und Ausschließung Biomedizinisch begründeten Vorhersagen und Diagnosen wird häufig ein besonders
sicherer, da objektiver Stellenwert zugeschrieben und neurobiologischen Erklärungen wird mehr Glauben geschenkt als psychosozialen. Von den ersteren geht offenbar ein verführerischer Zauber aus (Skolnick Weisberg u.a. 2008). Dieser wiederum kann die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit mittels biomedizinisch begründeter Präventionsmaßnahmen so nah und erreichbar erscheinen lassen, dass soziale wie amtliche Kontrolle stark zunehmen und andere Interessen verdrängt werden. Obwohl es im Interesse von Eltern sein kann, Unterstützung im Umgang mit möglichen kindlichen Verhaltensproblemen zu erhalten, ist es problematisch, wenn ihre diesbezügliche Entscheidungsgewalt im Interesse der öffentliche Sicherheit untergraben würde, wenn ihnen und ihren Kindern dementsprechende Programme von offizieller Seite aufgedrängt werden (Singh/Rose 2009) und wenn jegliche Ablehnung derselben als suspekt oder gar verwerflich angesehen wird. Desweiteren können vor allem genetische Screenings von – asymptomatischen – Kindern deren Recht auf Nicht-Wissen sowie ihre zukünftige Autonomie untergraben. Neben der (vermeintlichen) Objektivität biomedizinischer Erkenntnisse ergeben sich ethische Probleme bezüglich zunehmender amtlicher und sozialer Kontrolle auch hinsichtlich der eigentlichen Zielsetzung frühpräventiver Programme. Wenn nämlich das Wohlergehen betroffener Kinder im Vordergrund steht, stellt sich dieses Problem in ganz anderer, und 11
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
weniger scharfer Weise, als wenn die öffentliche Sicherheit das eigentlich Hauptanliegen ist. Im Gegensatz zu den bisher angesprochenen Sorgen, wird dieser Punkt allerdings auch bezüglich bestehender Präventionsprogramme ausführlich besprochen. Vor allem kritische Soziologen haben vielfach moniert, dass „Gewaltprävention“, oft ein bloß kosmetischer Anstrich vieler derartiger Programme sei, die stattdessen vor allem ein „institutionalisiertes Misstrauen“ gegenüber Kindern und Jugendlichen zum Ausdruck brächten und den Ausschluss sozialer Randschichten förderten (Muncie u.a., 2002). Auch wird vor der Korrumpierung der allgemeinen Jugendarbeit durch Kriminalitätsprävention gewarnt (Freund/Lindner, 2001), und widersetzen Experten sich gegen die Etikettierung „Gewaltprävention“ bei Programmen, die ursprünglich zur Unterstützung von Kindern und Familien entwickelt wurden, dann aber auch gewaltpräventive Nebenwirkungen zeigten (Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2007). Was den Punkt zunehmender sozialer Kontrolle betrifft, ist die Diskussion also bereits umfangreich und beschränkt sich keineswegs auf bioethisch begründete Sorgen über mögliche zukünftige Entwicklungen. Derzeit wird diese Debatte allerdings vor allem von Soziologen geführt, die bestehende Missstände anprangernd beschreiben. Ethisch fundierte Aspekte spielen hierbei eher eine untergeordnete Rolle. Ein Fokus hierauf ist aber notwendig, um einen normativen Rahmen zu entwickeln, der begründen kann, was als Missbrauch und was als zulässiger Gebrauch eines Interventionsprogrammes zu gelten hat, und wann, für wen, und unter welchen Umständen es angemessen ist, bestimmte Programme anzubieten oder gar aufzuerlegen. Aber auch hierbei dürfte der Abwägung individueller und öffentlicher Interessen eine größere Bedeutung zukommen, als der Frage, ob diese Interessen eher durch psychosozial oder biomedizinisch begründete Interventionen bedroht oder gewährleistet werden.
3.4.
Invasivität und Nebenwirkungen Neben den bisher besprochenen möglichen Folgeerscheinungen von Frühprävention,
wird aber auch die eigentliche Durchführung mit Sorge betrachtet. Zum einen wird den möglichen biomedizinisch begründeten Screenings vorgeworfen, invasiv zu sein und in die körperliche Integrität (noch) a-symptomatischer Kinder einzugreifen. Zum anderen wird das Risiko medizinischer Nebenwirkungen herausgestellt, welches insbesondere bestehen könnte, wenn psychopharmakologische Mittel eingesetzt werden. Deren Langzeitwirkungen 12
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
sind noch wenig bekannt und bergen deshalb gerade für Kinder ungeahnte Risiken (Singh/Rose 2009). Abschließend werden wir daher der Frage nachgehen, inwieweit bestehende psychosoziale Frühpräventionspraktiken auch diesen Problemen ausgesetzt sind. Körperliche Eingriffe bleiben im Falle von Fragebogenuntersuchungen, wie sie bei heutzutage üblichen psychosozialen Screenings durchgeführt werden, offensichtlich aus. Aber sind sie deshalb nicht-invasiv? Im Zuge derartiger Untersuchungen werden Eltern, wie auch ältere Kinder, gebeten, umfassend Auskunft zu geben über das Verhalten, die Gedanken und persönlichen Beziehungen ihrer Kinder, beziehungsweise über sich selber. Der universell eingesetzte „Stärken und Schwächen Fragebogen“ (Goodman 1997) fordert Eltern zum Beispiel auf anzugeben, ob ihr Kind häufig unglücklich, schnell ängstlich, oder hilfsbereit anderen gegenüber ist. Die selektiven Achenbach-Listen gehen noch weiter und enthalten unter anderem Fragen zur Grausamkeit des Kindes, darüber, ob es sich „wertlos oder unterlegen“ fühlt (Frage 35) oder „seltsame Gedanken oder Ideen“ hat (Frage 85) (Achenbach 1991). Dies mag unschuldig klingen. Allerdings können Fragen, die einen auffordern, sehr persönliche Informationen preiszugeben oder sein Kind in teils sehr negativen Begriffen zu beschreiben, als sehr eingreifend erfahren werden. Zudem muss bedacht werden, dass zumindest die universellen Fragebögen flächendeckend und routinemäßig von Eltern wie Lehrern ausgefüllt werden müssten und Eltern die verantwortlichen Fachkräfte, denen sie die Informationen aushändigen sollen, nicht kennen und keine Vertrauensbeziehung zu ihnen aufbauen können. Wenn sie auch keine Eingriffe in die körperliche Integrität darstellen, so können die derzeit eingesetzten Screeningmethoden durchaus psychologisch invasiv sein. Aus ethischer Sicht muss daher vor allem geklärt werden, wann genau Invasivität vorliegt, warum und unter welchen Bedingungen sie problematisch wäre und ob und warum das Sammeln biomedizinischer Informationen tatsächlich belastender sein kann als das Zusammentragen psychosozialer Daten. Biomedizinische Präventionsmaßnahmen basieren, zumindest teilweise, auf der Verabreichung von Psychopharmaka, die allerdings vor allem aufgrund ihrer möglichen Nebenwirkungen in der Kritik stehen (Singh/Rose 2009). Diese Kritik ist insbesondere in Bezug auf Kinder einschlägig, da deren Gehirne noch weniger ausgereift und plastischer sind. Dies impliziert allerdings nicht nur, dass psychopharmakologisch induzierte Verhaltensänderungen besonders nachhaltige Effekte bewirken könnten, sondern auch, dass 13
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
ungewünschte und schädliche Nebenwirkungen besonders dauerhaft wären. Aufgrund dieser Problematik hat Glannon (2007) vorgeschlagen, derartige Maßnahmen den schwersten Fällen jugendlichen antisozialen Verhaltens vorzubehalten und bevorzugter Weise auch nur auf freiwilliger Basis anzubieten. Dies allerdings schließt frühpräventive Anwendungen grundsätzlich aus. Auf den ersten Blick, und beinahe schon definitionsgemäß, scheinen psychosoziale Maßnahmen vor medizinischen Nebenwirkungen gefeit zu sein. Allerdings können auch diese Praktiken wegen ihrer potentiell stigmatisierenden, diskriminierenden oder sozial ausschließenden Wirkung das psychische Wohlbefinden betroffener Kinder negativ beeinflussen. Daher ist es aus ethischer Sicht sicherlich geboten, dass entsprechende Evaluationsstudien sich nicht auf die – kurzzeitigen – positiven Effekte beschränken, sondern gleichermaßen die ethischen Aspekte und möglichen negativen Langzeitwirkungen mit einbeziehen.
4
Schlussfolgerung Ziel dieses Beitrages war es, zu diskutieren, ob und inwieweit ethische Sorgen, die
derzeit an mögliche zukünftige biomedizinisch informierte Methoden der Frühprävention antisozialen Verhaltens herangetragen werden, in vergleichbarer Weise auch für bereits bestehende psychosozial begründete Praktiken gelten. Wie unsere Überlegungen aufzeigen, ist dies weitgehend der Fall. Dementsprechend besteht im derzeitigen ethischen Diskurs eine wichtige Lücke, die ihn bio-exzeptionalistisch erscheinen lässt: Der Diskurs fokussiert in seinen kritischen Momenten auf mögliche biomedizinische Entwicklungen, übersieht aber bestehende psychosozial begründete Praktiken. Was die Prävention von Jugendgewalt betrifft, ist dies besonders problematisch. Aus biomedizinischer Sicht wird regelmäßig auf die Bedeutung der Interaktionen von biomedizinischen und psychosozialen Faktoren hingewiesen. Die Frühprävention antisozialen Verhaltens beruft sich potentiell also auf sehr unterschiedliche Disziplinen. Ein einseitiger ethischer Fokus wird den Herausforderungen dieser Entwicklungen kaum gerecht werden können. Daher plädieren wir an dieser Stelle dafür, dass die ethische Bewertung heutiger wie zukünftiger Frühprävention in erster Linie wichtige Probleme aufzeigen und sich mit diesen auseinandersetzen sollte, unabhängig vom disziplinären Hintergrund möglicher Praktiken.
14
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503.
Literatur Achenbach, Thomas M. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist / 4-18 and 1991 Profile Burlington. AKJ Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (2007). Strategien der Gewaltprävention im Kindes- und Jugendalter, München. APA American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5, Arlington. Beauchaine, Theodore P/Neuhaus, Emily/ Brenner, Sharon L./Gatzke-Kopp, Lisa (2008). Ten good reasons to consider biological processes in prevention and intervention research. Development and Psychopathology, Jg. 20, H. 3, S. 745-774. Burnett, Ros., 2007. Never too early? Reflections on research and interventions for early developmental prevention of serious harm. In: Maggie Blyth/Enver Solomon/ Kerry Baker (Hg.) Young people and risk. London, S. 97-112. Farrington, David P./Coid, Jeremy W. (Hg.) (2003) Early prevention of adult antisocial behaviour, Cambridge. Farrington, David P./Welsh, Brandon C. (2007). Saving children from a life of crime, Early risk factors and effective interventions Oxford. Fishbein, Diana H. (2000). The science, treatment, and prevention of antisocial behaviors Kingston. Freund, Thomas/Lindner, Werner (Hg.) (2001) Prävention, Zur kritischen Bewertung von Präventionsansätzen in der Jugendarbeit, Opladen. Frick, Paul J./Petitclerc, Amelie (2009). The use of callous-unemotional traits to define important subtypes of antisocial and violent youth. In: Sheilagh Hodgins/Essi Viding/Anna Plodowski (Hg.) The neurobiological basis of violence: Science and Rehabilitation, Oxford, S.65-83 Glannon, Walter (2007). Bioethics and the brain, Oxford. Goodman, Robert (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. The Journal of Child Psychology and Psychiatry,Jg. 38, H. 5, S. 581-586. Hawkins, J. David/Herrenkohl, Todd I (2003) Prevention in the school years. In: David P. Farrington/Brandon C. Welsh (2007). Saving children from a life of crime, Early risk factors and effective interventions Oxford, S.265-291. Horstkötter, Dorothee/Berghmans, Ron/De Wert, Guido, (2011). Prävention antisozialen Verhaltens bei Kindern: Ethische Implikationen eines neurobiologischen Ansatzes Nervenheilkunde, Jg.30, H.12, S. 992-996. Levitt, Mairi/Manson, Neil C. (2007). My genes made me do it? The implications of behavioural genetics for responsibility and blame. Health Care Analysis, Jg. 15, H.1 ,S.33-40. McCrory, Eamon/De Brito, Stéphane A./Viding, Essi (2012). The link between child abuse and psychopathology: A review of neurobiological and genetic research. Journal of the Royal Society of Medicine, Jg. 105, S.151-156. Muncie, John/Hughes, Gordon/Mclaughlin, Eugene (Hg.) (2002) Youth justice, Critical readings, London. Nuffield Council on Bioethics, (2002). Genetics and human behaviour: the ethical context London. Ortiz, Jame/Raine, Adrian (2004). Heart rate level and antisocial behavior in children and adolescents: A meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Jg. 43, H.2, S. 154-162. Parens, Erik/Chapman, Audrey R./Press, Nancy (Hg.) (2006) Wrestling with behavioral genetics, Science, ethics and public conversation, Baltimore. Phelan, Jo C. (2005). Geneticization of deviant behavior and consequences for stigma: The case of mental illness. Journal of Health and Social Behavior, Jg.46, H.4, S.307-322. Rose, Nikolas (2000). The biology of culpability: Pathological identity and crime control in a biological culture. Theoretical Criminology, Jg.4, H. 1, S. 5-34.
15
Erschienen in G. Feuerstein & Th. Schramme (2015) Ethik der Psyche, Normative Fragen im Umgang mit psychischer Abweichung, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 487-503. Sanders, Matthew R./Turner, Karen M./Markie-Dadds, Carol (2002). The development and dissemination of the Triple P—Positive Parenting Program. Prevention Science, Jg. 3, H.3 , S. 173-189. Scheithauer, Herbert/Rosenbach, Charlotte/Niebank, Kay (2012). Gelingensbedingungen für die Prävention von interpersonaler Gewalt im Kindes- und Jugendalter Bonn: Deutsches Forum für Kriminalprävention. Shirtcliff, Elizabeth A./Vitacco, Michael J./Graf, Alexander R./Gostisha, Andrew J./Merz, Jenna L./Zahn-Waxler, Carolyn (2009). Neurobiology of empathy and callousness: Implications for the development of antisocial behavior. Behavioral Sciences and the Law, Jg.27, S. 137-171. Singh, Ilina/Rose, Nikolas (2009). Biomarkers in psychiatry. Nature, Jg.460, S. 202-207. Skolnick Weisberg, Deena/Keil, Frank C./Goodstein, Joshua/ Rawson, Elizabeth/Gray, Jeremy R. (2008) The seductive allure of neuroscience explanations. Journal of Cognitive Neuroscience, Jg.20, H.3, S. 470-477. Tremblay,Richard E/Japel, Christa (2003) Prevention during pregnancy, infancy and the preschool. In: David P. Farrington/Brandon C. Welsh (2007). Saving children from a life of crime, Early risk factors and effective interventions Oxford, S. 205-242. Van Goozen, Stephanie H.M./ Fairchild, Graeme (2008). How can the study of biological processes help designing new interventions for children with severe antisocial behavior? Development and Psychopathology, Jg. 20, H.3, S.941-973. Viding, Essi/Larsson, Henrik /Jones, Alice P (2009) Quantitative genetic studies of antisocial behavior. In: Sheilagh Hodgins/Essi Viding/Anna Plodowski (Hg.) The neurobiological basis of violence: Science and Rehabilitation, Oxford, S. 251-264. Wasserman, David/Wachbroit, Robert (Hg.) (2001) Genetics and criminal behavior, Cambridge. WHO World Health Organisation (2004) ICD-10: International statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision, Genf.
16