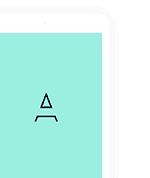Transcript
Bachelor-Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades »Bachelor of Arts (B. A.)« vorgelegt im Januar 2013 im Studiengang Erziehungswissenschaften Fachbereich Erziehungswissenschaften JWG-Universität Frankfurt am Main
Von der Mädchen- und Jungenarbeit zur queeren Pädagogik? Zur Entwicklung nach Judith Butlers »Gender Trouble« [überarbeitete Fassung]
Vorgelegt durch: Jean O. Matrikel-Nr.: … Anschrift: … …@stud.uni-frankfurt.de Betreut durch: …
Inhaltsverzeichnis Einleitung........................................................................................................................................................................... 1 I. Genealogische Betrachtungen von Geschlecht....................................................................................................... 4 a. Auffassungen von Geschlecht vor der »poststrukturalistisch-dekonstruktiven Wende«........................5 b. Butlers neue Perspektiven auf Geschlecht, Körper und Sexualität................................................................ 7 II. Queer Theory und ihre pädagogisch-erziehungswissenschaftliche Relevanz.................................................12 a. Was ist Queer Theory?......................................................................................................................................... 12 b. Erziehungswissenschaftliche und pädagogische Relevanz............................................................................ 15 III. Mädchen- und Jungenarbeit.................................................................................................................................. 22 a. Entwicklung und Leitmotive der (feministischen) Mädchen- und Jungenarbeit..................................... 22 b. Relikte und Konflikte – Kritik an heteronormativer Mädchen- und Jungenarbeit.................................28 IV. Queere Pädagogik?.................................................................................................................................................. 34 a. Grundzüge einer möglichen queeren Pädagogik............................................................................................ 35 b. Das Dilemma einer queeren Pädagogik zwischen Wirkmächtigkeit und Dekonstruktion....................40 c. Praktische und methodische Ansätze queerer Pädagogik............................................................................. 42 Abschließende Bemerkungen....................................................................................................................................... 46 Literatur- und Quellenverzeichnis.............................................................................................................................. 49
Einleitung Meiner Arbeit liegt eine Perspektive auf Identität zugrunde, die sich aus dem Poststrukturalismus speist. Poststrukturalistische Theorien haben in den letzten Jahrzehnten in wissenschaftlichen Diskursen, bislang vor allem an Universitäten in den Vereinigten Staaten und Kanada, Bedeutung erlangt. Als Beispiele dieser Impuls-gebenden Theorie-Felder ließen sich etwa die Postkoloniale Theorie, Critical Whiteness Studies oder die Gender-Studies bzw. die Queer Theory nennen. Betrachtet man Literatur aus dem Bereich der deutschsprachigen Erziehungswissenschaften, so muss man jedoch erkennen, dass nur eine marginale Auseinandersetzung mit notwendigen »Verschiebungen« bestimmter Diskurse und Praxen in Hinblick auf neuere poststrukturelle, dekonstruktive – auch dekonstruktivistische genannt – Theorien stattfand. Auch die erziehungswissenschaftliche Rezeption der Queer Theory fällt eher verhalten aus. Und doch lässt sich in der Jungen- und Mädchenarbeit eine (verhaltene) Entwicklung zu queeren Ansätzen feststellen – diese Arbeit soll diese Entwicklungen nachvollziehbar aufzeigen und eine Vorstellung davon vermitteln, wie eine queere Pädagogik aussehen könnte. Dabei möchte ich mich unter anderem folgenden Fragen widmen: Geht mit Butlers Infragestellung der Kategorie der »Frau(en)« als Subjekt des Feminismus bzw. ihrer generellen Absage an »Kollektivsubjekte«, das Subjekt einer Mädchen- bzw. Jungenarbeit verloren? Und ist mit Butlers Kritik der Heteronormativität auch die Jungen- und Mädchenarbeit abzulehnen? Ist die Mädchen- und Jungenarbeit also angesichts der poststrukturalistischen Entwicklungen ein überholtes Konzept, das Ausschlüsse und Hierarchien produziert anstatt »befreiend« zu wirken? Und gibt es eine alternative, vielleicht queere Pädagogik, die an die Stelle von Mädchen- und Jungenarbeit treten kann? Lässt sich der emanzipatorische Anspruch einer feministischen Pädagogik mit dem Anspruch nach Verflüssigung von Identitäten einer Queer Theory zusammendenken? Eine Annahme, die in der Arbeit belegt werden soll, ist, dass Geschlecht in den Erziehungswissenschaften zwar bereits als eine für Prozesse der Sozialisation und des Aufwachsens wichtige Strukturkategorie erkannt wurde, ohne jedoch das essentialistische Verständnis von Geschlecht grundsätzlich verändert zu haben. Dieser Rückgriff auf essentialistische Geschlechterbilder ist vor allem dann zu beobachten, wenn die Erziehungswissenschaften nicht mit bildungstheoretischen, sondern mit bildungspraktischen Fragen konfrontiert werden. Zur »Verteidigung« der Pädagog_innen lässt sich sagen, dass auch sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem die Vorstellung von Geschlecht als binärem System in (fast) allen Bereichen von Alltagswirklichkeit eine soziale und kulturelle Selbstverständ1
lichkeit ist und in der sie als Beobachter_innen und Akteur_innen immer schon verstrickt sind. Daraus ergibt sich eine für diese Arbeit grundlegende Frage: Kann bei alledem eine »VerUneindeutigung« (Engels 2005, 297) von Geschlecht ohne Rückgriff auf eben jene essentialistische Geschlechterbilder (also ohne erneut Heteronormativität1 zu reproduzieren) pädagogisch umsetzbar sein? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, gibt es trotzdem Ansätze, denen man einen »queeren« Anspruch zugestehen kann? Ich werde mich in der Arbeit hauptsächlich auf deutschsprachige, erziehungswissenschaftliche Literatur beziehen. Es soll versucht werden, anhand dieser Literatur Teile der (deutschsprachigen) Debatte um eine »geschlechtsbezogene Pädagogik« – so der Überbegriff für die diversen Ansätze – nachzuzeichnen. Wenn man sich in der Literatur umschaut, so zeigt sich, dass zu Queer Theory auf der theoretischen, erziehungswissenschaftlichen Ebene vergleichsweise wenig, an der Schnittstelle von Theorie zur Praxis noch weniger, gearbeitet wurde. Neues – zumindest auf wissenschaftlich-publizistischer Ebene – gibt es kaum. Als wichtige Werke und Texte sowohl für diese Arbeit als auch für die erziehungswissenschaftliche Rezeption der Queer Theory allgemein sind Jutta Hartmann (2001, 2004, 2009, 2012), Melanie Plößer (2005, 2009), Rosemarie Ortner (2007), Gesa Heinrichs (2002), Jenny Ho wald (2001), Olaf Stuve (2001, 2004) und Corinna Voigt-Kehlenbeck (2001) zu nennen. Auch der Sammelband »Feministische Mädchenarbeit weiterdenken«, herausgegeben von Mart Busche und anderen (2010a) sowie der Band »Dekonstruktive Pädagogik«, veröffentlicht unter anderen von Bettina Fritzsche (2001a), sind in dieser Arbeit von größerer Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Jungen- und Mädchenarbeit waren vor allem die Bücher »Mädchen- und Jungenarbeit in den Erziehungshilfen« von Michael Behnisch und Kerstin Bronner (2007) sowie »Mädchenarbeit« von Renate Klees und anderen (1989) sehr hilfreich. Neben Texten dieser Autor_innen sind als wesentliche Quellen schließlich auch die Werke von Judith Butler (1991, 2001) und Heide von Felden (2003) zu nennen. Die Arbeit gliedert sich dabei in vier inhaltliche Kapitel. In den ersten beiden Kapiteln werde ich die 1 Nach Hartmann setzt heteronormatives Denken »Heterosexualität als gesellschaftliche Norm, benötigt Homosexua lität als das Andere zur Bestätigung von Heterosexualität und transportiert Vorstellungen von essenziellen bezie hungsweise substanziellen und damit lebenslang gleichbleibenden Identitäten« (Hartmann 2001, 69). Bei der Ver wendung des Begriffs »Heteronormativität« wird die »wechselseitige Verwiesenheit von Geschlecht und Sexuali tät« (Hartmann 2004, 22), sowie die Tatsache, dass »Heterosexualität als ein Machtverhältnis [zu verstehen ist], das alle wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche, ja die Subjekte selbst durchzieht« (ebd.), betont. Der Begriff ist eng mit dem der »heterosexuellen Matrix« verknüpft (siehe dazu Kapitel I b).
2
theoretischen Grundlagen für die Bearbeitung der Fragestellung darstellen. Dazu wird im ersten Kapitel Geschlecht mit seinen Brüchen und Diskontinuitäten geschichtlich eingeordnet, wobei die Veränderungen der Betrachtungsweise von Geschlecht, Sexualität und Körper im Kontext der Veröffentlichung von Judith Butlers »Gender Trouble« ausführlicher behandelt werden. Im zweiten Kapitel wird in die Queer Theory eingeführt. Es sollen dabei Grundbegriffe und Grundkritiken erläutert werden. Weiterhin soll mittels der Literatur überprüft werden, welche unterschiedlichen Zugänge es zur Frage nach der erziehungswissenschaftlichen Relevanz gibt, also aus welchen Gründen sich die Erziehungswissenschaften mit Geschlecht, Sexualitäten und anderen Differenzkategorien aus einer queer-feministischen Perspektive auseinandersetzen sollten oder gar müssen. Die »klassischen« Konzepte der Mädchen- und Jungenarbeit und ihre Entwicklung werden im dritten Kapitel vorgestellt und sodann einer Kritik aus poststrukturalistischer, queerer Sicht unterzogen. Im Anschluss daran sollen in einem vierten Kapitel Überlegungen zu den theoretischen Grundzügen einer möglichen queeren Pädagogik angestellt und auf damit einhergehende Dilemmata eingegangen werden. Zudem sollen (Ansätze von) Praxen einer queeren Pädagogik vorgestellt werden, um zur methodischen Weiterentwicklung anzuregen. Am Schluss der Arbeit wird kurz auf das Argument gegen queere Konzepte eingegangen, sie beförderten neoliberale Tendenzen. Zudem soll erneut auf die Situation im Kinderladen eingegangen und ein Fazit gezogen werden. Bevor nun aber zum ersten Kapitel übergegangen wird, seien einige Anmerkungen zur eigenen Perspektive gemacht: Ich bewege mich in bestimmten Räumen in einem (queer-)feministisch geprägten Umfeld, in dem Geschlechterverhältnisse thematisiert werden und man sich auf politischer sowie persönlicher Ebene damit auseinandersetzt.2 Mit dem Themenbereich Gender-Studies bzw. Queer Theory bin ich – vielleicht erst wegen des privaten Umfeldes – im Laufe meines Studiums häufiger in Kontakt gekommen.3 Durch die nun schon länger andauernde Beschäftigung mit dem Thema hat sich bei mir eine gewisse awareness gegenüber der Strukturkategorie Geschlecht entwickelt. Für mich mag also eine Sensibilisierung gegenüber Ungleichheiten entlang der Strukturkategorie Geschlecht gängig erscheinen. Doch bin ich dabei keineswegs frei von normativen Vorstellungen. Damit ist klar: meine »eigene Interpreten-Position« (Steinert 1989, 68), meine »eigenen Vorannahmen und ihre 2 Dass sich das Umfeld mal »damit« auseinandergesetzt hat, bedeutet (leider) keinesfalls, dass man nun keine problematischen Handlungsweisen mehr an den Tag legt bzw. gegenüber Sexismus und Homophobie »unter sich« ge schützt ist. 3 Die Arbeit wäre im Übrigen in diesem Umfang nicht möglich gewesen, wenn ich nicht schon über entscheidende theoretische Grundlagen verfügt und einen groben Überblick über die Literatur gehabt hätte.
3
emotionale Besetzung« (ebd., 78) sind ohne Frage vorgeformt. Daher, jedoch auch weil der Fokus auf Geschlecht und Sexualität unter Umständen den Blick auf andere Problemfelder verstellen kann, kann ich keinen objektiven, neutralen Standpunkt gegenüber den Themen, die in der Arbeit behandelt werden sollen, einnehmen, und dem Grundsatz der Reflexivität folgend, will ich dies auch nicht verschleiern. Es soll vielmehr versucht werden meine eigene Subjektposition, Vorannahmen und – sofern sie denn erkannt werden – Auslassungen in der Arbeit zu reflektierten.4 Schließlich möchte ich noch auf sprachliche »Besonderheiten« in dieser Arbeit hinweisen. Sprache steht immer in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Verhältnissen: Sie wird durch Gesellschaft zwar beeinflusst, spiegelt sie also gewissermaßen wider, gleichzeitig jedoch wirkt sich Sprache wiederum auf eben diese Verhältnisse aus. Wenn sich nun in der Sprache beispielsweise heteronormative, patriarchale Strukturen abzeichnen, ist dies vor einem emanzipatorischen und (queer-)feministischen Hintergrund problematisch. In der Arbeit werden deshalb männliche Formen für undefinierte und größere Personengruppen vermieden, da Männlichkeit keine Norm darstellen soll. So wird aus »den Autoren« »die Autor_innen«. Der Unterstrich eröffnet hierbei einen Raum für Menschen, für die in der Vorstellung einer binären, heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit kein Platz zu sein scheint.5
I. Genealogische Betrachtungen von Geschlecht Ob Geschlecht – wie Heinrichs es vertritt – als die »primäre systematische Kategorie [zu] versteh[en ist], die zur Installation und Legitimation gesellschaftlicher Hierarchisierung geführt hat« (Heinrichs 2002, 160) oder ob andere Strukturkategorien oder Differenzkategorien 6 als wichtiger oder gleichwertig zu betrachten sind, ist Gegenstand feministischer Debatten.7 Fest steht, dass Geschlecht 4 Die Wichtigkeit dieser Reflexion betonen die Pädagoginnen Ines Pohlkamp und Regina Rauw auch für die Praxis. Sie fordern, dass, »[u]m Heteronormativität zu dekonstruieren, […] sich die Pädagog_in […] mit ihren eigenen Mäd chen- und Jungenbildern und ihrer eigenen Gender-Inszenierung auseinandersetzen« (Pohlkamp/Rauw 2010, 24) müssen. 5 Für konkrete Beispiele einer feministischen Kritik (wohlgemerkt vor dem Einfluss poststrukturalistischer Theorien) an der deutschen Sprache sei auf die Erziehungswissenschaftlerin Claudia Böger verwiesen (Böger 1995, 121ff.). Für die Schreibweise mit dem Unterstrich, auch »Gender_Gap« genannt, sei auf den Text »Performing the Gap« von S_He (2003) (ein Pseudonym für Steffen Kitty Herrmann) verwiesen. 6 Lenz unterscheidet nach »Strukturkategorien, die wie Klasse, ›Rasse‹, Geschlecht und (heterosexuelles, homosexu elles, queeres) Begehren systematisch mit Ungleichheiten in der Gesellschaftsstruktur verbunden sind« (Lenz 2010, 159) und »Differenzkategorien, also vielfältige Unterscheidungen zwischen Menschen und Gruppen, die zu Diskriminierungen in verschiedensten Kontexten führen können« (ebd.). Um wiederum den Einfluss bei der Subjektbil dung zu beschreiben, wird vom Überbegriff »Identitätskategorie« (ebd.) gesprochen. Wie auch andere Kategorien lässt sich Geschlecht mit einer konstruktivistischen Sicht nie eindeutig einem der drei Begriffe zuordnen (vgl. ebd., 160). 7 Rosemarie Ortner betont beispielsweise die fehlende Mitberücksichtigung von »ökonomische[n] Subjektzumutungen« (Ortner 2007, 43), was zur Gefahr einer neoliberalen Vereinnahmung feministischer Bildungskonzepte führen
4
eine enorme Rolle in unserem Alltag spielt und Hierarchisierungen (mit-)strukturiert. Die Mädchen- und Jungenarbeit sowie die ersten Ansätze einer queeren Pädagogik reflektieren dies und fordern – auf ihre jeweilige Weise – einen kritischen Umgang mit der Kategorie Geschlecht. Daher soll in diesem Kapitel zunächst Geschlecht und Geschlechterdifferenz und die historischen Ausprägungen bzw. die unterschiedlichen Auffassungen betrachtet werden. Dabei liegt ein von Michel Foucault geprägtes genealogisches Verständnis von Geschichte und »Wahrheit« zugrunde, dass »nicht nach Ursachen, sondern nach Entstehungsprozessen« (Engel 2007, 290) fragt und somit erlaubt, Subjekte, Geschlecht und Sexualität als Effekte von vergangenen wie gegenwärtigen Diskursen, »Macht/Wissen-Komplexe[n] und sozialen Praxen« (ebd., 291) zu analysieren. a. Auffassungen von Geschlecht vor der »poststrukturalistisch-dekonstruktiven Wende« Im westlich-europäischen Raum war Geschlecht zunächst als Bezeichnung für das heutige »Adelsgeschlecht« üblich und erst Ende des 18. Jahrhunderts mit der »bürgerlichen Epoche wurde die Bedeutung von Geschlecht in unserem heutigen Alltagsverständnis gebräuchlich« (Kreisky 2004, 26) – aus Geschlecht wurde ein »biologisierender Differenzbegriff« (ebd.). In der Wissenschaft wie im Alltag begann man Männer und Frauen auf ihre Unterschiede hin zu untersuchen und die Vorstellung einer Zweigeschlechtlichkeit etablierte sich (vgl. Honegger 1991, 168ff.).8 Ausgegangen wurde gemeinhin »von einem unhinterfragten biologischen Unterschied […], dem entsprechende psychische Merkmale zugehörten« (Faulstich-Wieland 1997, 234). Diese biologischen Unterschiede 9 legitimierten unterschiedliche Rechte und Pflichten in der bürgerlichen Gesellschaft – gemäß dem androzentrischen Charakter der Aufklärung verlief die »Verteilung« jener Anrechte und Aufgaben in aller Regel zugunsten der Männer (vgl. Dausien/Thon 2009, 340). Für den Feminismus10 der Nachkriegszeit – hier ist als Persönlichkeit vor allem Simone de Beauvoir 11 könnte. 8 Für eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung der (biologischen) Geschlechtertheorien von der griechischen Antike bis heute sei auf das Buch »Geschlecht – Wider die Natürlichkeit« von Heinz-Jürgen Voß verwiesen (vgl. Voß 2011). 9 Begrifflichkeiten wie »biologischer Unterschied«, »natürliches Geschlecht«, » das Weibliche« etc. sind aus einer queeren Perspektive als problematisch anzusehen. Um einen Vorgriff auf jene Perspektive und neuere Entwicklungen in diesem Bereich zu vermeiden, werden die Begriffe dennoch so verwandt, wie sie im jeweils vorgestellten Ansatz ge braucht werden bzw. wurden. 10 In dieser Arbeit kann die komplexe Geschichte des Feminismus nicht dargelegt werden. Es sei daher lediglich darauf hingewiesen, dass es »den Gleichheitsfeminismus« ebenso wenig gegeben hat, wie »den Differenzfeminismus« etc. – die Positionen unterschieden und unterscheiden sich je nach Autor_in und Lesart (vgl. von Felden 2003, 102). 11 Simone de Beauvoir brachte mit ihrem Buch »Das andere Geschlecht« von 1949 das wohl wichtigste Werk dieser Zeit heraus. Das Buch war angesichts der auch in Hinsicht auf die Geschlechterverhältnisse restaurativen Züge der Nachkriegszeit beeindruckend modern und ist heute – glaubt man dem Autoren Heinz-Jürgen Voß – auch in Hin blick auf poststrukturalistische Theorien »erstaunlich aktuell« (Voß 2011, 14).
5
zu nennen – sowie der sogenannten »zweiten Welle« der Frauenbewegung ab den 1960er Jahren war die Trennung von (biologischem) Geschlecht (sex) und Geschlechtsidentität (gender) bzw. Natur und Kultur (vgl. Wilchins 2006, 145) ein zentrales Thema.12 Gleichheitsorientierte Ansätze argumentierten, dass Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sozial und kulturell geprägt seien, aber keine biologische Grundlage besäßen. Mit der Aufkündigung der »Selbstverständlichkeit, dass Geschlecht eine ›von Natur aus‹ gegebene und an biologischen Merkmalen eindeutig ablesbare Tatsache ist« (Dausien/Thon 2009, 336), wurden Ungleichbehandlungen, die mit biologischen Unterschieden bzw. sich daraus ableitenden Rollenzuweisungen legitimiert wurden, politisch angreifbar (vgl. ebd.). Die Trennung von sex und gender ermöglichte es der Frauenbewegung »dem hegemonialen Diskurs über die ›natürliche Bestimmung der Geschlechter‹ entgegenzutreten« (Heinrichs 2002, 150) und somit fehlende Rechte einzuklagen. Frauen – so der Ansatz – müssten die gleichen rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Chancen wie Männer haben (vgl. von Felden 2003, 82f.). Differenzfeministische Theorien behielten die Unterscheidung zwischen sex und gender bei, sprachen Frauen ebenso gleiche Möglichkeiten zu, konzipierten aber gleichzeitig zwei komplementär gedachte Geschlechter. Als Reaktion auf die gleichheitsfeministische »Revolte gegen Weiblichkeit« 13 (Young 1989, 38) wurde die Zweigeschlechtlichkeit anders als beim Gleichheitsansatz sowohl im Bereich sex wie auch gender betont14 und Weiblichkeit bzw. weiblichen Tätigkeiten ein positiver Wert an sich zugemessen (vgl. von Felden 2003, 88f.).15 Wie Yvonne Ehrenspeck in ihrem Überblicksbeitrag »Strukturalismus und Poststrukturalismus in der Erziehungswissenschaf« zeigt, wurde durch den Einfluss vorwiegend französischer Vertreter_innen16 poststrukturalistischer Theorien das Subjekt- und Identitätsverständnis der Erziehungswissenschaften schon ab den 1980er Jahren in Frage gestellt (vgl. Ehrenspeck 2001). Auch die Einsicht, dass 12 Sex bezeichnet das »biologische Geschlecht« bzw. verweist auf den »natürlichen Genus« (Kreisky 2004, 33). Gen der hingegen meint das »soziale Geschlecht«, das auf geschlechtsspezifische Rollenerwartungen und Verhaltensweisen verweist und in der kulturellen Sphäre verortet wird (vgl. ebd.). 13 Der Gleichheitsdiskurs wurde unter anderem dafür kritisiert, dass er sich an männlichen Maßstäben orientierte und der Weiblichkeit keinen eigenen Wert zuerkannte (vgl. von Felden 2003, 89). 14 In den Ansätzen vor allem italienischer Feminist_innen (z.B. die Gruppen Liberia delle donne di Milano oder Diotima) wurde dementsprechend ein »Modell einer weiblichen Gegengesellschaft« (ebd., 88) propagiert – man sollte sich als Frau nicht mehr an die männlich dominierte Gesellschaft und deren Normen angleichen, sondern sich an ei ner eigenen weiblichen Ordnung orientieren. 15 Radikalen Formen des Differenzfeminismus wurde vorgeworfen, die Herrschaftsverhältnisse zwischen Männern und Frauen zu reproduzieren: Wenn Mütterlichkeit und care-work als derart positiv gewertet werden, warum müsse man dann Frauen vor der Reduktion auf diesen Bereich schützen (vgl. Young 1989, 59f.) bzw. wie kann man sie schützen, wenn man sich nicht in (vermeintlich) männliche Räume wie die Politik etc. einmischt (vgl. ebd., 62)? 16 Ehrenspeck nennt mit Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jaques Derrida, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze und Jaques Lacan ausschließlich männliche Personen (vgl. Ehrenspeck 2001, 21). Als weibliche Vertreter_innen wären hier zum Beispiel Sarah Kofman oder Luce Irigaray zu nennen.
6
Geschlechterdifferenz durch Handlungen erst sozial hergestellt wird, war schon vor der Veröffentlichung von Judith Butlers »Gender Trouble« vorhanden. So war in der deutschsprachigen Diskussion die Debatte um »doing gender«17 mit Carol Hagemann-White ab Mitte der 1980er Jahre aufgekommen (vgl. von Felden 2003, 98). Bedingt durch die beharrliche Aufrechterhaltung der Prämisse einer Zweigeschlechtlichkeit, wurde in Bezug auf die Aufnahmewilligkeit dieser Theorien im Nachhinein jedoch von einer »Rezeptionssperre in der deutschsprachigen Diskussion gegenüber konstruktivistischen Ansätzen«18 (ebd.) gesprochen. Die Theorien der Sprachwissenschaftlerin und Philosophin Butler kamen demnach nicht aus dem »Nichts«, sondern waren eingebettet in eine langjährige Debatte und stimmen an vielerlei Stellen mit den Ergebnissen der ethnomethodologischen19 Ansätze überein. Man könnte nun fälschlicherweise meinen, Butlers Leistung bestünde einzig darin, schlicht als Erste gehört worden zu sein und die »Rezeptionssperre« durchbrochen zu haben. Tatsächlich waren ihre Schriften zwar dafür verantwortlich, dass »auch bundesdeutsche Forscherinnen begannen, sich mit den erkenntnistheoretischen Perspektiven des Konstruktivismus zu befassen« (ebd., 93). Butler bot mit ihrem Werk jedoch auch »eigene« gewichtige und provokante Neuerungen, die dazu führten, dass heute weitestgehend anerkannt ist, dass Butler synonym für einen Perspektivwechsel in der (deutschen) Geschlechterforschung steht (vgl. von Felden 2003, 98). b. Butlers neue Perspektiven auf Geschlecht, Körper und Sexualität Im Jahre 1990 erschien das Buch »Gender Trouble« von Judith Butler in seiner ersten Auflage. Die Thesen, die Butler in jenem Buch – in der deutschen Ausgabe »Unbehagen der Geschlechter« genannt – vertritt, stellen einen Bruch mit den (meisten der) eben vorgestellten Auffassung von Geschlecht, Körper und Subjekt dar. 17 Bei dem Analyseansatz »doing gender« wird betont, dass es sich bei Geschlecht um eine soziale Konstruktion han delt, die über alltägliche Interaktionen hergestellt wird (vgl. von Felden 2003, 94f.). Der Ansatz ist beeinflusst durch ethnomethodologische Arbeiten (Harold Garfinkel) und solche aus dem Symbolischen Interaktionismus (Erving Goffman) und war im angloamerikanischem Raum (Candace West und Don H. Zimmermann) schon Ende der 1970er Jahre verbreitet (vgl. ebd., 94). Regine Gildemeister und Angelika Wetterer erneuerten die sozialkonstruktivistischen Interpretationen ab 1992 für den deutsch-sprachigen Raum nochmals (vgl. Dausien/Thon 2009, 338). 18 Von Felden unterscheidet mit Barbara Rendtorff zwischen Konstruktivismus als eine Theorie, die das »Wie« einer Konstruktion untersucht, und Dekonstruktivismus als eine Methode oder Verfahren, die die »Idee der Konstruktion selbst« (Derrida) hinterfragt (vgl. von Felden 2003, 98f.). 19 Wie beschrieben, greift das Konzept des doing gender auf ethnomethodologische Methoden zurück und bezieht diese auf Geschlecht. Die von Harold Garfinkel Ende der 1960er Jahre geprägte Ethnomethodologie ist ein qualitativ aus gerichteter Forschungsansatz, der »an den Routinen des Alltags und ihrer Herstellung interessiert ist« (Flick 2007, 82). Mit der Methode wird untersucht, wie Menschen in Interaktionen soziale Wirklichkeit herstellen (vgl. ebd., 86). In Hinblick auf Geschlecht und Geschlechterdifferenz kann so die »Herstellung von Gender in Praktiken und Interaktionen […] sowie […], wie die Unterscheidung der Geschlechter in alltäglichen und institutionellen Handlungswei sen hergestellt wird« (vgl. ebd., 99), betrachtet werden.
7
Butler stellt zunächst die Zweigeschlechtlichkeit in Frage: »Setzen wir für einen Augenblick die Stabilität der sexuellen Binarität (binary sex) voraus, so folgt daraus weder, daß das Konstrukt ›Männer‹ ausschließlich dem männlichen Körper zukommt, noch daß die Kategorie ›Frauen‹ nur weibliche Körper meint. Ferner: Selbst wenn die anatomischen Geschlechter (sexes) in ihrer Morphologie und biologischen Konstitution unproblematisch als binär erscheinen […], gibt es keinen Grund für die Annahme, daß es ebenfalls bei zwei Geschlechtsidentitäten, bleiben muß.« (Butler 1991, 23 – Hervorh. i. Orig.)
Das heißt selbst bei einer Aufrechterhaltung der Trennung von sex und gender würde »Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt« (ebd.) und könnte auch Formen jenseits der Kausalität »sex führt zum entsprechend übereinstimmenden gender« annehmen (vgl. Hartmann 2012, 155). In Anlehnung an Michel Foucault und dessen Auffassung der Nicht-Existenz prädiskursiver Gegebenheiten lehnt Butler darüber hinaus auch die Idee von einer Aufteilung von Geschlecht in sex und gender ab: »Mit Foucault geht Butler […] davon aus, dass es kein Außerhalb der Macht gibt und sexuelle/ geschlechtliche Identitäten und Begehren nicht die zu befreiende Kehrseite der Macht sondern regulierte Produkte dieser sind. Subjekte sind immer Effekte, denen kein nicht-diskursives Davor zugrunde liegt. Damit denkt Butler das Verhältnis von sex und gender neu: sex sei definitionsgemäß immer schon gender gewesen.« (Tuider 2004, 186)
Laut Butler gibt es also kein a-priori-Geschlecht, das einem gesellschaftlichen Diskurs »vorgeschaltet« wäre. Vielmehr bringt der Diskurs erst die Vorstellung von dem vermeintlich natürlichen/biologischen Geschlecht hervor (vgl. Hartmann 2012, 156). Butler geht weiter und beschreibt auch den Körper als kulturell und diskursiv hergestellt. Der Körper wird für gewöhnlich als direkt verknüpft mit dem biologischen Geschlecht angesehen. Der materielle oder anatomische Körper wird dann oft als eine Hülle verstanden, die von Kultur gefüllt wird (vgl. Butler 1991, 26). Der Körper, ähnlich dem biologischen Geschlecht, wird als »seinen kulturellen Einschreibungen vorgängig« (ebd., 193) gedacht, das heißt als dem Diskurs (scheinbar) vorgelagert. Allerdings entstehen materielle Körper nach Butler überhaupt nur durch Diskurse: »Die Unbestreitbarkeit des ›biologischen Geschlechts‹ oder seiner ›Materialität‹ ›einzuräumen‹ heißt stets, dass man irgendeine Version des ›biologischen Geschlechts‹, irgendeine Ausformung von ›Materialität‹ anerkennt. Ist nicht der Diskurs, in dem und durch den dieses Zugeständnis erfolgt […] selbst formierend für genau das Phänomen, das er einräumt?« ( Judith Butler 1995: Körper von Gewicht, zit.n. Hartmann 2012, 156 – Auslassung i. Orig.)
Das heißt nun nicht, dass Butler bestreitet, dass es Körper gebe – allerdings sind Körper gleichfalls keine »reine natürliche Materie« (Hartmann 2012, 156), sondern durchzogen von kulturellen Interpretationen und daher nicht »vordiskursiv« als vielmehr kulturell »erweiterbar« (vgl. ebd.).
8
Gegen Butlers Vorstellung von Körpern als etwas diskursiv Hergestelltem, dem keine Bestimmung und kein »wahrer Kern« innewohnt, wird oftmals das Argument der »biologischen Tatsachen« angeführt. Obwohl diese Arbeit aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive verfasst ist, ist im Zusammenhang mit sex und anatomischem Körper relevant, auf das Argument der »biologischen Tatsachen« einzugehen, das oft gegen dekonstruktive Ansätze angeführt wird. In weiten Teilen der Biologie ist die Vorstellung hegemonial, dass es Männer und Frauen »gibt« und Mädchen sich körperlich und geistig »anders« entwickeln als Jungen (und vice versa). Begründet wird dies mit biologisch angelegten Dispositionen (vgl. Voß 2011, 122ff.). Gleichzeitig sind sich die derzeit in der westlichen Welt hegemonialen Ansätze in Biologie, Medizin und Psychologie uneins, was genau einen Mann bzw. eine Frau ausmache: Ist Geschlecht chromosomal, gonadal, morphologisch, hormonell, zentral-neuronal oder genetisch bestimmt (vgl. Schmitz 2006, 36f.)? Schon allein wegen der Vielzahl der sich widersprechenden Erklärungsmuster und der damit nicht eindeutig setzbaren Trennlinie zwischen den beiden »üblichen« Geschlechtern (vgl. ebd. 54), ist es interessant, was Untersuchungen hervorbringen, die Unterschiede in der Entwicklung geschlechterübergreifend suchen. Der durch poststrukturalistische Theorien beeinflusste Biologe Heinz-Jürgen Voß zeigt zum Beispiel auf, dass die Vorstellung von nur zwei Geschlechtern in den Naturwissenschaften alles andere als unumstritten ist bzw. war (vgl. Voß 2011, 68ff.). Gleichzeitig stellt Voß alternative Deutungen in der Biologie, oder wie er es ausdrückt »aktuell überzeugendere Theorien für menschliche Geschlechtlichkeit« (ebd., 165), abseits von binären Geschlechtsvorstellungen vor und stemmt sich damit gegen die nur scheinbare Objektivität der Naturwissenschaften.20 In einer heteronormativen Gesellschaft gibt der Körper als »Ort«, an dem sich das biologische Geschlecht »materialisiert« hat, vor, welches soziale Geschlecht man hat und welches (andere) Geschlecht man begehrt – Abweichungen hiervon erscheinen als »unnatürlich«. Butler zeigt im Zusammenhang mit der Frage nach Regulierungsverfahren bei der Herstellung einer »intelligiblen« Identität – also einer »anerkannten« oder »sozial lebensfähigen« Person (vgl. Hartmann 2012, 156) – auf, dass enorme Zwänge vorliegen (vgl. Butler 1991, 38f.). Intelligibel kann eine Person nur dann sein, wenn eine »Kohärenz und Kontinuität zwischen dem anatomischen Geschlecht (sex), der Geschlechtsidentität (gender), der sexuellen Praxis und dem Begehren« (ebd., 38 – Hervorh. i. 20 Als eine Herangehensweise, die weder biologische noch kulturelle bzw. gesellschaftliche Faktoren bei der Ge schlechtsbildung ignoriert, scheint der essentialismus-kritische Embodiment-Ansatz plausibel: »Der EmbodimentAnsatz versteht biologisches und kulturelles/soziales Geschlecht als vernetzt und sich beständig gegenseitig beeinflus send.« (Schmitz 2006, 34 – Hervorh. i. Orig.). So sei beispielsweise die Frage nach der Wirkung vergeschlechtlichter, sozialer Praxen zum Beispiel auf neuronale Strukturen ein bislang wenig untersuchtes Forschungsfeld (vgl. ebd.).
9
Orig.) vorliegt und aufrechterhalten wird. Dieses ideologische System der zwanghaften »Deckungsgleichheit« der drei Kategorien bezeichnet Butler als »heterosexuelle Matrix«: »Butler setzt den Begriff der heterosexuellen Matrix ein, um darauf aufmerksam zu machen, wie die so gesetzte Kohärenz der Geschlechtsidentität an ein heterosexuelles System gebunden ist und wie die Heterosexualität eine eindeutige Zweigeschlechtlichkeit erfordert. Geschlecht und Sexualität bringen sich über dieses Regulierungsprinzip in einer Weise hervor, die die potentielle Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Möglichkeiten begrenzt.« (Hartmann 2012, 156f.)
Mittels des redundanten Verweises auf die jeweils andere Kategorie erscheint dabei Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit als »natürlich« und »Norm«: »Mal leitet sich das Begehren aus dem Geschlecht ab, mal wird über das Begehren Geschlecht erst verankert. Mal folgt aus dem Körper eine bestimmte soziale Rolle, mal erzeugt eine bestimmte Rolle ein bestimmtes Begehren usw. […] Heterosexualität kann mit Hilfe des Begriffs der heterosexuellen Matrix also als ein Herrschaftssystem dargestellt werden, das Körper und ihr Verhältnis zueinander normiert und diese aufgezwungene Ordnung als natürlichen Grundzustand legitimiert.« (Woltersdorff 2003,917)
Dabei wird – wie beim »biologischem Geschlecht« bzw. dem Körper – verschleiert, dass es sich um Diskurseffekte und nicht um Ursprünge und Ursachen handelt (vgl. Butler 1991, 24). Zur Sichtbarmachung dieses »naturalisierenden Tricks« folgt Butler Foucaults Machtverständnis und seiner Methode der genealogischen Kritik (vgl. ebd., 9): »Die Vorstellung, daß es eine ›Wahrheit‹ des Sexus geben könne, […] wird gerade durch die Regulierungsverfahren erzeugt, die durch die Matrix kohärenter Normen der Geschlechtsidentität hindurch kohärente Identitäten hervorbringen.« (ebd., 38)
Zusammenfassend lassen sich mit Jutta Hartmann drei Kern-Thesen von Butler nennen: Butler formuliert eine »deutliche Absage an eine wie auch immer als natürlich gedachte Basis der Geschlechtlichkeit« (Hartmann 2012, 152). Weiterhin stellt Butler »die Zweigeschlechtlichkeit […] in Frage – und damit auch den bislang unhinterfragten Referenzpunkt feministischer Pädagogik und erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung« (ebd.). Zudem betont Butler die »Verwobenheit von Geschlecht und Sexualität, die vermittelt über eine heterosexuelle Matrix nicht nur Zweigeschlechtlichkeit stabilisiert, sondern über die Norm der Heterosexualität auch heterosexuelles Begehren naturalisiert wie privilegiert« (ebd.). Diesen drei Thesen ist gemeinsam, »dass sie den normativen Charakter von Aspekten der Kategorie Geschlecht herausarbeiten, die gemeinhin als naturgegeben gelten, nun jedoch als Effekte von Machtwirkungen lesbar sind« (ebd.). Die diskursive Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität geschieht durch »Akte, Gesten, artikulierte und inszenierte Begehren« (Butler 1991, 200), also »performativ« (ebd.). Nach Jutta Hartmann bedeutet »Geschlecht als performativ zu verstehen […], dessen vermeintliche Natür10
lichkeit als Wirkung wiederholten Zitierens gesellschaftlicher Geschlechternormen zu begreifen« (Hartmann 2001, 76). Bei dieser permanent notwendigen Wiederholung (Butler 1991, 206) – hier sehen einige Autor_innen die Möglichkeit der Rückgewinnung der angeblich fehlenden Handlungsfähigkeit des postmodernen Subjekts (vgl. Hartmann 2001, 75ff.) – komme es immer zu »Kopierfehlern«, also (meist sehr kleinen) Bedeutungsverschiebungen (vgl. Ortner 2007, 31f.). Die Bedeutung der performativen Auffassung von Geschlecht liegt darin, dass sie nicht wie die herrschende (Geschlechter-)Ordnung einer heteronormativen Matrix verhaftet bleibt, sondern mit ihrem »Modell der Performativität von Geschlecht […] sowohl den konstitutiven Zwang zu einer kohärenten Geschlechtsidentität als auch auftretende Instabilität und Diskontinuität geschlechtlicher Identität« (Hartmann 2004, 20) betont. Diese Instabilität kann als Ausgangspunkt für eine Veränderung von heteronormativen Geschlechtsbildern dienen. In diesem Sinne schreibt Ines Pohlkamp: »Performativität birgt die Idee der Veränderung von Geschlechtsidentitäten und Genderpräsentation in sich« (Pohlkamp 2010, 46 – Hervorh. J.S.)
Subjekte werden auch über sprachliche Akte hergestellt. Interpellation oder Anrufung ist nach Butler21 »kein Ereignis, sondern eine ganz bestimmte Inszenierung des Rufes« (Butler 2001, 101 – Hervorh. i. Orig.), wobei nicht so sehr der Ruf als solcher, sondern vielmehr die Wirkung dessen bedeutsam sei. Die Anrufung kann als »ein Erklärungsmodell für ein Subjekt, das als Konsequenz aus der Sprache entsteht« (ebd.) dienen. Sofern der_die »Rufer_in« Autorität besitzt, wirkt die Anrufung ungemein stark, sodass man sich ihr »fast nicht entziehen kann« (ebd., 105). Mit sprachlichen Mitteln kann so »ein Subjekt ins soziale Dasein hineingezwungen« (ebd.) werden. Ungeachtet dieser Autorität jedoch wird sich der_die Angerufene wahrscheinlich (verbal oder gedanklich) dazu positionieren und somit einer Formung der eigenen Identität von Außen (ungewollt) stattgeben. Anja Tervooren hat gezeigt, wie sich Interpellation gerade in pädagogischen Settings auf die Herausbildung der Geschlechtsidentität auswirken kann (Tervooren 2006, 78ff.): Sie untersucht dabei eine Szene, in der ein Lehrer die Strukturkategorie Geschlecht wählt, um Schüler_innen für eine spezielle, körperliche Arbeit auszuwählen und mit dem Spruch »Wir nehmen mal Jungs diesmal.« Mädchen wie Jungen zugleich, aber in unterschiedlicher Weise22 »anruft«. Spätestens mit Butlers Buch »Gender Trouble« von 1990 wurde eine neue Perspektive auf Geschlecht und die damit zusammenhängende Pädagogik notwendig (vgl. Plößer 2005, 9f.). Schließ21 Butler wiederum bezieht sich auf Louis Althusser der von Interpellation im Zusammenhang mit Macht, Schuld und Gewissen spricht. 22 Mädchen werden in ihrer vermeintlichen »Nicht-Eignung« für körperliche Arbeiten, Jungen in ihrer vermeintlichen Eigenschaft als »stark« und körperbetont angesprochen.
11
lich wurde mit den Schriften von Butler den Begriffen »Mann« und »Frau« die Selbstverständlichkeit genommen – sie waren »nicht länger […] gegebene Gewissheiten« (Hartmann 2004, 29). Butler »initiiert […] Bedeutungsverschiebungen und macht die Mehrdeutigkeit, Inkohärenz und Instabilität der scheinbar eindeutigen Begriffe zugänglich« (Hartmann 2012, 154). Das Identitäts- und Subjektverständnis sowohl des Feminismus als auch der Pädagogik wurde in Frage gestellt: »Nach Butlers Subjektverständnis erweisen sich Subjekte als Wirkung sozialer Normen und diskursiver Machtbeziehungen.« (ebd., 171)
Es lässt sich mit Butler zeigen, »mittels welcher Begriffe und Argumentationen [auch] der feministische Diskurs Normierungen produziert« (Plößer 2005, 91) und »welche Ausschlüsse und Hierarchien durch diese Normen legitimiert werden« (ebd.). Auch die Pädagogik und die Erziehungswissenschaften im Allgemeinen müssen sich daher – wie im Folgenden gezeigt wird – mit den poststrukturalistischen und queeren Perspektiven auseinandersetzten. Zuvor soll jedoch geklärt werden, worauf der Begriff »queer« verweist.
II. Queer Theory und ihre pädagogisch-erziehungswissenschaftliche Relevanz a. Was ist Queer Theory? Für den Begriff »queer«23 gibt es unterschiedliche Gebrauchsweisen im deutschen Sprachraum, sei es als Label für Partys oder einen Christopher-Street-Day, als Form eines politischen Aktionismus oder als eine Kategorie, die alles bezeichnet, was abseits oder zwischen heteronormativer Binarität liegt24 (vgl. Tuider 2004, 186f.). Queer »steht im akademischen Kontext heute für eine identitätsund machtkritische Auseinandersetzung mit dem Themengebiet Sexualität und Geschlecht« (Hartmann 2012, 159) und wird in diesem Zusammenhang als »Queer Theory« bezeichnet. Auch wenn die Grenzen zwischen den beiden Bereichen oft fließend sind (vgl. Woltersdorff 2003, 916), seien demgegenüber auch die aktivistischer auftretenden »Queer-Politics« genannt, deren Entstehung Tuider wie folgt kontextualisiert: »Aus dem Rassimus- [sic] und Heterosexismusvorwurf der women of colours an den weißen Mittelschichtsfeminismus und die Patriarchatskritik lesbischer Aktivistinnen an die Homo-Politik resultierten nicht-identitäre Vorstellungen von Bündnispolitiken, wie sie Queer praktiziert.« (Tuider 2004, 185f. – Hervorh. i. Orig.)
Die Queer Theory orientiert sich stark an den Erkenntnissen von Butler. Butler zeigt auf – wie be23 Howald übersetzt den englischen Begriff »queer« mit »schräg, gefälscht, sonderbar, fragwürdig, homosexuell« (Howald 2001, 296 – Hervorh. i. Orig.). Der Begriff wurde als »homophobes Schimpfwort« (Hartmann 2012, 159) bzw. als »negativ konnotierter Begriff für Homosexuelle« (Tuider 2004, 186) genutzt. Ab Anfang der 1990er Jahre wurde er subversiv verwendet und damit von der schwul-lesbischen Szene positiv gewendet (vgl. ebd.). Der Begriff »queer« wurde – was allzu oft vergessen wird – allerdings schon vor den 1990ern von den Trans- und People of Co lour-Communities zur eigenen Beschreibung genutzt (vgl. Engel 2007, 287; Haritaworn 2005, 26). 24 Tuider nennt dabei »Lesben und Schwule, Bisexuelle, trigenders, polysexuals, pansexuals, crossdressers, transgenders, Intersexuelle, Transsexuelle, SM’s, Fetischistlnnen« (Tuider 2004, 187) als Beispiele.
12
reits ausgeführt wurde – wie wichtig die Berücksichtigung von (Hetero-)Sexualität als Machtkategorie bzw. die Offenlegung ihres verdeckten Normierungs- und Strukturierungscharakters im Zusammenhang mit der heterosexuellen Matrix ist (vgl. Hartmann 2012, 157). Es ist eben dieser »Aus schnitt« aus Butlers Werk, der in der Frauen- und Geschlechterforschung meist unbeachtet blieb, jedoch für die Queer Theory zentral ist (vgl. ebd.): »Queer Theory hebt in besonderer Weise die Bedeutung der Sexualität für die Konstituierung moderner Identitäten hervor […].« (ebd., 173 – Hervorh. i. Orig.)
Die Queer Theory ist darüber hinaus alles andere als eine einheitliche, in-sich-kohärente Theorie (vgl. Howald 2001, 296). Sie stammt schließlich nicht alleine aus der Feder von Judith Butler, sondern wird – auch Dank des Einflusses der Queer Politics – ständig transformiert. Bereits die »Entstehungsgeschichte« ist umstritten, wird aber meist auf den Anfang der 1990er datiert (vgl. Haritaworn 2005, 25). Queer Theory zeichnet sich nach Antke Engel durch eine Zurückweisung ahistorischer, universeller Wahrheiten und Normen aus und formuliert eine radikale Kritik an (essentialistischen) Identitätskonstruktionen (vgl. Engel 2007, 285ff.). Engel versteht dabei Identität und Differenz gemäß Butler als komplexe, in Machtprozessen entstandene Produkte, die nichts natürliches oder gottgegebenes an sich haben (vgl. ebd., 288). Aus einer queeren Perspektive sollen (Subjekt-)Positionierungen und Entscheidungen so getroffen werden, dass deren »Offenheit, Veränderbarkeit und Konflikthaftigkeit« (ebd., 289) nicht verloren geht. Zugleich darf es bei alledem »nicht darum geh[en], Kategorien abzuschaffen« (Howald 2001, 296), noch darum sie durch eine »Idee neutraler Allgemeinheit, in der Differenz undenkbar wird« (Engel 2007, 296), zu ersetzen. Die Queer Theory stellt stattdessen die Forderung nach gesellschaftspolitischer Veränderung hin zu mehr Vielfalt und einer Auflösung von »Normalität« in den Mittelpunkt (vgl. ebd., 298), wobei »hegemoniale gesellschaftliche Machtverhältnisse in Frage« (Howald 2001, 296) gestellt werden. Mit anderen Worten: Der Queer Theory geht es um einen »neuen Umgang mit Identitäten, bei dem es nicht um die Anerkennung von Andersheit geht, sondern um die kritische Infragestellung derjenigen symbolischen Ordnungen, durch die die Vorstellungen von ›normal‹ und ›anders‹ immer auch erst produziert wird« (Plößer 2009, 60). Anders als etwa im doing gender nimmt Queer Theory auch Machtrelationen in den Fokus: »Mit der queer theory gibt es ein Analyseinstrument, das den Fokus der Frage nach der geschlechtlichen (Re-)Produktion von dem ›Wie‹ des Konzeptes des doing gender […] auf das ›Warum‹ verschiebt und dadurch bestehende Machtverhältnisse sichtbar macht.« (Nagel 2010, 251 – Hervorh. i. Orig.)
13
Die Queer Theory orientiert sich dabei am Machtverständnis von Foucault, der »Macht nicht nur repressiv, sondern auch produktiv« (Woltersdorff 2003, 917) versteht. Mit diesem veränderten, queer-theoretischen Machtverständnis ist es möglich, Macht als dezentriert zu begreifen – nicht (nur) eine herrschende Klasse oder Geschlecht übt alleinige Macht über andere aus, sondern alle Menschen sind in unterschiedlicher Weise an der machtvollen Durchsetzung von Normen beteiligt (vgl. ebd.). Dabei beschränkt sich diese Sicht nicht nur auf Machtverhältnisse in Bezug auf Geschlecht. Der Queer Theory liegt vielmehr eine intersektionelle Perspektive zugrunde, sie nimmt »diverse Ungleichheitskategorien in den Blick« (Pohlkamp 2010, 51). Queer Theory hinterfragt also zwangsläufig nicht nur Heteronormativität, sondern beschäftigt sich ebenfalls mit anderen Differenzkategorien, wie (Nicht-)Behinderung, natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit (vgl. Tunç 2006, 51), Klasse, Entsprechen von Schönheitsvorstellungen, Religion oder Alter,25 die allesamt in Gruppen mit einem »wir« und einem »die Anderen« einteilen. Diesem Aufteilen in zwei Gegensätze liegt ein binäres Denken nach wahr/natürlich und falsch/unnatürlich zugrunde, das, wie Jenny Howald zeigt, Hierarchien erzeugt: »Dieses Denken in Binaritäten, das auf einer eindeutigen und ›natürlichen‹, somit unwiderruflichen Differenz besteht, kann nur durch ein starres Innen und Außen funktionieren und produziert notwendigerweise Hierarchien.« (Howald 2001, 299)
Dies zeigt Howald am Beispiel der Sexualität: »Die Kategorie Sexualität baut auf der kulturellen Konstruktion der Geschlechtsidentität auf und unterstützt diese gleichzeitig, indem sie zwischen ›natürlichen‹ Frauen und Männern, die heterosexuell sind, und ›unnatür lichen‹, die homosexuell sind, unterscheidet.« (ebd.)
Mit der Setzung der einen Form von Sexualität als »normal«, werden alle anderen26 zu eben jenen »Anderen« und damit »anormal«.27 Die Queer Theory kritisiert binäres Denken allgemein: »Die poststrukturalistischen, queeren Kritiken haben seit Beginn der 1990er Jahre […] darauf hingewiesen, dass Macht nicht nur zwischen Differentem, sondern vielmehr in der Konstruktion des Differenten wirkt und durch die Herstellung von ›brauchbaren‹ und ›unbrauchbaren‹ Subjekten funktioniert.« (Tuider 2004, 180f.)
Diese Hierarchisierung zieht nun auch Normierungen, Diskriminierungen und Ausschließungen nach sich.28 Und so erscheinen auch die Dualismen Mann/Frau, weiß/Schwarz29, behindert/nicht be25 Butler bescheinigt einem solchen Versuch der Aufzählung von Kategorien ein immer-währendes, aber lehrreiches »Scheitern« (Butler 1991, 210). 26 In erster Linie grenzt sich Heterosexualität gegen Homosexualität ab, aber ebenso werden auch andere Formen nicht-»phallozentristische[r] Sexualität« (Howald 2001, 300) diskriminiert. 27 Hier zeigt sich wieder der Vereindeutigungszwang: Möchte man nicht »im Abseits« stehen, muss man sich der Norm anpassen – darin drückt sich ein Zwang aus, der im von Adrienne Rich geprägten Begriff der »Zwangsheterosexualität« seinen Ausdruck findet (vgl. ebd., 299). 28 Olaf Stuve zeigt dies eindrücklich am Beispiel der Zweigeschlechtlichkeit, also der Dichotomie Mann/Frau (vgl. Stu ve 2001, 283f.). 29 Durch die Großschreibweise von Schwarz bzw. die Kursiv-Setzung von weiß soll daran erinnert werden, dass race – die englische Schreibweise schließt an die im englisch-sprachigem Raum schon länger existente Diskussion um »na -
14
hindert etc. problematisch. Wie auch Geschlecht sind die mit diesen Dichotomien korrelierenden Kategorien sehr wirkmächtig – nur wirken sie nicht ausschließlich für sich alleine, sondern vor allem, wenn sie interferieren. Die Intersektionalitätsstudien rücken so »einerseits […] die Simultanität multipler kategorialer Zugehörigkeiten und andererseits […] deren gegenseitige Einflussnahme« (Marion Müller 2003: Geschlecht und Ethnie, zit.n. Tunç 2006, 44) in den Fokus ihrer Betrachtung. 30 Die Tatsache, dass die Queer Theory einen solchen Blick teilt, lässt sich nicht nur aus ihrer Geschichte heraus verstehen.31 Auch wegen der genannten Kritik an der binären Aufteilung von Strukturkategorien allgemein, muss die Queer Theory »die intersektionelle Verschränkung von Geschlecht und Sexualität mit anderen Normensystemen« (Tuider 2004, 187) zwangsläufig mitdenken.32 Dekonstruktive Theorien wollen feministische Politiken »durch das Aufdecken der ihr eigenen Unbegründbarkeiten, Unentscheidbarkeiten und Unreinheiten zu neuen Politisierungsprozessen und zu neuen Verantwortlichkeiten anregen« (Plößer 2005, 39). Und tatsächlich hat sich das »Irritationspotential der Butlerschen Theorie« (Hartmann 2012, 152) als »maßgeblicher Motor einer neuen Grundlagendebatte« (ebd.) erwiesen. Nicht nur innerhalb der Geschlechterforschung (vgl. ebd., 154), auch in den Erziehungswissenschaften gab es – wenn auch vergleichsweise wenige (vgl. ebd., 151)– durchaus Beiträge, die sich mit dem Thema auseinandersetzten. b. Erziehungswissenschafliche und pädagogische Relevanz Doch warum müssen sich die Erziehungswissenschaften und die Pädagogik überhaupt mit Queer Theory beschäftigen? Ich möchte hier zwei Aspekte näher ausführen. Der erste zielt auf die genuintio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit« (Tunç 2006, 51) an – keine Aussage über körperliche Existenz macht, sondern vielmehr einen sozialen und kulturellen Status darstellt (vgl. Albrecht-Heide 2005, 444). Da es sich bei weiß – im Gegensatz zu Schwarz – nicht um eine politische Selbstbezeichnung handelt, wird der Begriff hier klein geschrieben (vgl. Hornscheidt 2005, 486). 30 Schaut man sich beispielsweise die Effekte an, die beispielsweise Migration auf Männlichkeiten und Weiblichkeiten hat (vgl. Tuider/Huxel 2010), kann man den Migrationskontext als einen »Verhandlungs- und Aushandlungsraum definieren, in dem sowohl Geschlecht und das Geschlechterverhältnis als auch die ethnische Zugehörigkeit in Frage gestellt werden« (ebd., 89). 31 Die Etablierungsphase der Queer Theory im Umfeld der Frauen-, Homosexuellen- und Transsexuellenbewegungen sowie den Protesten von women of colour gegen den weißen Mittelstandsfeminismus »begünstigt« eine Betrachtung von miteinander in Beziehung tretenden kategorialen Zugehörigkeiten (vgl. Tuider 2004, 185f.). Jinthana Harita worn zeigt auf, dass gerade Betrachtungen der Entstehung der Queer Politics und Queer Theory dem Anspruch eines intersektionellen Blicks nicht gerecht werden (vgl. Haritaworn 2005). 32 Hartmann warnt jedoch, dass man mit einer »Erweiterung des Blicks auf Differenzierungen von Geschlecht entlang von weiteren Kategorien wie Ethnizität, Behinderung oder Klasse« (Hartmann 2012, 168) »identifikatorischem Denken« (ebd.) nicht zwangsläufig entkommen könne. Hartmann sieht »Intersektionalität nicht als ein Heilmittel gegen die Gefahr der Reproduktion von Zweigeschlechtlichkeit« (ebd.). Sie plädiert vielmehr dafür, innerhalb der Kategorie Geschlecht die Brüche und damit die eigentliche »Elastizität« (ebd.) sichtbar zu machen (vgl. ebd.).
15
erziehungswissenschaftliche Aufgabe der Fruchtbarmachung von theoretischen Erkenntnissen für die Praxis ab, der zweite auf die Aufgabe der Pädagogik, Gesellschaft »positiv« zu verändern und gewaltvolle Zuschreibungen zu verringern. Zudem soll dem Vorwurf der fehlenden Alltagsrelevanz widersprochen werden. Sowohl Plößer als auch Voigt-Kehlenbeck betonen, dass die »Suche nach den praktischen Konsequenzen theoretischer Einsichten […] eine zentrale Aufgabenstellung der feministischen Pädagogik« (Plößer 2005, 9) markiert bzw. die »Frage nach den Konsequenzen eines theoretischen Forschungszusammenhanges für die pädagogische Praxis […] eine bekannte Anforderung an die Erziehungswissenschaft« (Voigt-Kehlenbeck 2001, 237) ist.33 Mit der Entwicklung in der Geschlechterforschung und den Feminismen von einer differenzierenden hin zu einer queeren Perspektive auf Geschlecht stellt sich für die Erziehungswissenschaften also die Frage, was sich für die bestehende pädagogische Praxis mit dem Einfluss des Dekonstruktivismus ändert. Mittlerweile sind durchaus queere bzw. dekonstruktive Ansätze in die Diskussionen eingeflossen (vgl. bspw. Fritzsche et al. 2001a; Plößer 2005; Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. 2009; Busche et al. 2010a; Balzer/Ricken 2012a). Ein (allmählicher) Wandel zeichnet sich zum Beispiel – wie ich zeigen werde – in der Jungen- bzw. Mädchenarbeit ab. Doch – so schreibt Corinna Voigt-Kehlenbeck 2001 – mangele es an Konzepten zur Umsetzung: Die neuen Entwicklungen müssten schließlich erst von den Theoretiker_innen verarbeitet werden, bevor überhaupt die Frage »…und was heißt das für die Praxis?«34 gestellt werden könne (vgl. Voigt-Kehlenbeck 2001, 245). Dass dies alles andere als eine einfache Aufgabe ist und eine gewisse Zeit benötigt, soll hier nicht in Frage gestellt werden. Im Jahr 2011 schien der turn jedoch noch immer nicht vollzogen zu sein: Wenn die renommierte Erziehungswissenschaftlerin Barbara Rendtorff35 in ihrem Beitrag »Ge33 Dass die theoretischen Einsichten selten aus den Erziehungswissenschaften selbst stammen, sondern Anleihen aus anderen Disziplinen sind, ist Grund für innerdisziplinäre Selbstwertprobleme (vgl. Balzer/Ricken 2012b, 9). Diese ver meintliche Schwäche sei nach Nicole Balzer und Norbert Ricken aber als Stärke der Erziehungswissenschaften zu ver stehen: Sie zwingt zu der Einsicht, dass »Grundlagen geradezu kategorisch als unabgeschlossen und überwindbar gelten können und müssen« (ebd., 10) und zu einer »theoretisch reflektierte[n] Unbestimmtheit« (ebd.) auf die man einzugehen habe und die es auszugestalten heiße. Diese ständige Arbeit mit der eigenen Disziplin, sich selbst und den Grundbegriffen treffe sich gut mit dem den poststrukturalistischen Theorien eigenen Versuch »der Überwindung begrifflicher und kategorialer Dichotomien, die […] das […] Ineinander von Selbst- und Anderenbezüglichkeit nicht angemessen zu erfassen vermögen« (ebd., 11). Das »Rüstzeug« zu einer Veränderung ist demnach vorhan den. 34 Titel des Beitrags von Voigt-Kehlenbeck im Sammelband » Dekonstruktive Pädagogik« (vgl. Voigt-Kehlenbeck 2001). 35 Rendtorff war lange Zeit Vorstandmitglied und Vorsitzende der Sektion ›Frauen- und Geschlechterforschung‹ in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften DGfE (vgl. Rendtorff 2012) und kann nicht zuletzt deswegen als Indikator für die »herrschende Meinung« innerhalb der Erziehungswissenschaften gelten.
16
schlecht« zum Band »Pädagogisches Wissen – Erziehungswissenschaf in Grundbegriffen« den Diskurs um Queer Theory und Dekonstruktivismus komplett aussparen konnte, erweckt dies den Anschein, jene Theorien seien für die erziehungswissenschaftliche Debatte nicht relevant (vgl. Rendtorff 2011). Jutta Hartmann sieht die Schriften Butlers in der pädagogischen Geschlechterforschung zwar mittlerweile breit(er) diskutiert (vgl. Hartmann 2012, 164). Doch die Pädagogik hat in ihren Augen »mit der Berücksichtigung der gendertheoretischen Erkenntnisse Judith Butlers erst begonnen« (ebd., 173). Neben der Tatsache, dass die erziehungswissenschaftliche Rezeption der Queer Theory »tendenziell heteronormativ« (ebd.) verbleibt, bedauert sie – im Jahr 2012 – schon wieder eine Abnahme bzw. ein »Decrescendo pädagogischer Aufmerksamkeit« (ebd.). Auch Plößer kritisiert die Tatsache, dass bislang zwar Erkenntnisse aus der zweiten Frauenbewegung in pädagogische Praxen umgesetzt wurden, Erkenntnisse aus einer dekonstruktiven Perspektive jedoch nicht (vgl. Plößer 2005, 10), womit eine Grundprämisse (feministischer) Pädagogik – Theorien für die Praxis fruchtbar zu machen – verletzt werde (vgl. ebd., 9). Plößer spricht in diesem Zusammenhang von »einem Riss zwischen der theoretischen Fokussierung der Geschlechterdifferenz innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung auf der einen und dem pädagogisch-praktischen Umgang mit der Differenz auf der anderen Seite« (ebd., 11). Man kann also – zumindest im Moment – davon sprechen, dass die Erziehungswissenschaften ihrer Aufgabe, theoretische Erkenntnisse – in diesem Fall aus den Gender-Studies – in praktische Konzepte umzusetzen, nicht gerecht werden. In der vorliegenden Arbeit wird dafür plädiert, sich nun endlich der erziehungswissenschaftlichen Aufgabe der Implementierung von theoretischen Erkenntnissen in die Praxis zuzuwenden und den genannten »Riss« zu kitten: Es muss – mit den Worten Plößers – eine »Zusammenführung von dekonstruktiver Kritik und feministischer Praxis« (ebd., 10) bzw. eine »Rückbindung der Erkenntnisse und Forschungsergebnisse an die pädagogische Praxis« (ebd.) stattfinden. Bedauerlich und erstaunlich zugleich ist bei alledem, dass eine Umsetzung der neuen, poststrukturalistischen Entwicklungen in die Praxis schon vor mehr als zehn Jahren als »nicht mehr aufzuschieben« (Voigt-Kehlenbeck 2001, 245) galt. In dieser Arbeit wird zudem davon ausgegangen, dass einer emanzipatorischen Erziehungswissenschaft und Pädagogik eine transzendierende Perspektive auf Gesellschaft zugrunde gelegt werden muss. Dazu gehört auch, dass der »Leidensdruck« von Menschen verringert werden muss. Doch darf dieser Anspruch weder in einer passiven »Elendsverwaltung« enden, noch darf es eine aus17
schließliche Fokussierung von vermeintlich »Betroffenen« bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Mehrheitsnormen geben. Statt also normstabilisierend zu wirken und bestimmte Menschen als Opfer zu pathologisieren, muss es vielmehr Ziel einer emanzipatorischen Pädagogik sein, die Gesellschaft dahingehend zu transformieren, dass »das gute Leben« allgemein möglich(er) wird. Auch deshalb – so wird nun gezeigt – müssen sich die Erziehungswissenschaften mit queer-theoretischen Kritiken auseinandersetzen. Einige Autor_innen sehen dies als unumgängliche Notwendigkeit, die mit der postmodernen Perspektive auf Geschlecht einhergehe. Ortner schreibt dazu: »Feministische Bildungstheorie, so sie sich als emanzipatorisch versteht und dafür eintritt, die einzelnen Individuen im Bildungsprozess nicht ungebrochen verschiedenen gesellschaftlichen Anforderungen auszusetzen […], sondern um Begründung dafür ringt, herrschaftlicher Verfügung über Einzelne pädagogisch zu entgegnen, muss diese [postmoderne und neoliberale] Herausforderungen aufnehmen.« (Ortner 2007, 29f.)
Hartmann sieht die (feministische) Erziehungswissenschaft ebenfalls im Zugzwang: »Mit Butlers Konzentration auf die Gleichzeitigkeit von normativer Beschränkung und verändernder Handlungsfähigkeit des Subjekts und mit den dieser Fokussierung zugrunde liegenden gendertheoretischen Erkenntnissen sind zentrale pädagogische Fragestellungen tangiert und spezifische Herausforderungen an etablierte Denkweisen nicht nur in feministischer Pädagogik und erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung aufgeworfen.« (Hartmann 2012, 150)
Für Hartmann ist Bildung per se emanzipatorisch, da »die Idee der Befreiung aus vorgegebenen Denk- und Ordnungsmuster[n] […] dem Begriff der Bildung inhärent« (ebd., 150) sei. Beiden Autorinnen ist also gemeinsam, dass sie Erziehungswissenschaften, Bildung und Pädagogik die Aufgabe zuerkennen, gesellschaftliche Zumutungen und gewaltvolle Zuschreibungen zu verhindern. Diese Auffassung von pädagogischen Aufgaben spiegelt sich auch in der Praxis wider: Die beiden Autor_innen Michael Drogand-Strud und Regina Rauw sehen die »Motivation zum Handeln […] oft aus dem Drang zu Veränderung einer Situation, die Leid oder Schmerz mit sich bringt« (Drogand-Strud/Rauw 2010, 268) entstehen. Doch – und hier wird es für diese Arbeit interessant – die Sicht darauf, was genau Leid und Schmerz verursacht, hat sich gewandelt: Während es für Drogand-Strud und Rauw in den 1990er Jahren Frauen waren, »die einen Leidensdruck mit sich gebracht haben« (ebd.), sei heute oftmals ein Bewusstsein um die Diskriminierung durch die Zweigeschlechtlichkeit in Hinblick auf Menschen abseits der Eindeutigkeiten der dichotomen Norm vorhanden (vgl. ebd.). Diese Dichotomien bzw. Dualitäten – auch in Bezug auf andere Strukturkategorien – begreift Hartmann mit Jaques Derrida »als ›gewaltsame Hierarchie‹ und ›konfliktgeladene und unterwerfende Struktur des Gegensatzes‹« (Hartmann 2004, 19). Die Vorstellung einer Zweigeschlechtlichkeit stellt einen solchen »Zwang zur Zuordnung« (Voigt-Kehlenbeck 2001, 250) dar. Diesbezüglich hat 18
es laut Björn Nagel zwar diskursive Verschiebungen gegeben, aber dennoch beschreibt er die »gewaltsame Einteilung als äußerst funktional und stabil« (Nagel 2010, 249). Bei einer Erziehungswissenschaft, die Gewalt und Zwang ablehnt, kann schon angesichts des in der Gesellschaft weit verbreiteten, oft gewalttätigen Sexismus, der Homo- sowie Transphobie der Anspruch erhoben werden, 36 dass an der Entweder-Oder-Vorstellung von Geschlecht und der Vorstellung von heterosexuellem Begehren als Norm gerüttelt werden muss. Nagel schreibt dazu: »Die von dem (medialen) Mainstream der Gesellschaft als außerhalb der Norm stehend bezeichneten Lebensrealitäten von trans- und intersexuellen Menschen und die daraus resultierenden, täglich für diese Menschen erfahrbaren Diskriminierungen bis hin zu Übergriffen, die ihr Leben gefährden […], wären eigentlich schon Grund genug, die zweigeschlechtliche Ordnung unserer Gesellschaft in ihrer (Re-)Produktion zu hinterfragen, Alternativen aufzuzeigen und andere Räume zu öffnen.« (ebd., 251)
Die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit ist tief in Alltagshandlungen verankert, sie wird ständig reproduziert und erfährt meist nur oberflächliche Veränderung (vgl. Voigt-Kehlenbeck 2001, 244). Die Pädagogik und die darin angelegten Praxen und Handlungen sind davon alles andere als ausgenommen. Sie ist vielmehr eingebunden in den Prozess der Reproduktion von Geschlechterverhältnissen und aktiv daran beteiligt (vgl. Plößer 2005, 11; Hartmann 2012, 151). Doch besteht der Leidensdruck nur für Menschen »außerhalb der Norm«? Kritiker_innen könnten so einwerfen, eine Beschäftigung mit Queer Theory wäre (weiterhin) nur für die »Sonderpädagogiken« von Nöten, die sich mit Trans- und Intersex-Menschen beschäftigen. Dieses Argument wird entkräftet, wenn man sich dekonstruktivem Denken öffnet: Jede_r wird feststellen können, in seiner_ihrer Biographie gewaltvolle Situationen erlebt zu haben (vgl. Nagel 2010, 251). Die Zuschreibungen per Interpellation beginnen bereits mit der Geburt37: »Spätestens bei der Geburt wird jedes Baby einer der beiden Geschlechterkategorien zugeordnet. So sieht es die gesellschaftliche Praxis vor.« (ebd., 248) 36 Zwar kann an dieser Stelle nur ausschnittsweise auf das Problem eingegangen werden, doch sollen die hier herangezo genen Befragungen zeigen, wie brisant das Thema (noch immer) ist: I n einer Studie der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen München geben so zum Beispiel 31,7 % der befragten lesbischen Frauen an, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beschimpft worden zu sein (vgl. KGL 2004, 18). Eine Befragung von über 17.000 schwulen und bisexuellen Männern durch MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin wiederum zeigt, dass 40,6 % der Befragten Opfer von schwulen-feindlicher Gewalt wurden (vgl. MANEO 2009, 35). Wie das gesellschaftliche Klima in Bezug auf Transsexuelle aussieht, davon gibt die Befragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2008 einen Eindruck: Dort stimmten 45 % der Proband_innen der Aussage »Für Transsexuelle, das heißt, für Menschen, die ihr Geschlecht umgewandelt haben oder die es umwandeln wollen, habe ich kein Verständ nis.« zu (vgl. Antidiskriminierungsstelle 2008, 65). 37 Die Anrufung beginnt bereits mit der »Benennung als Mädchen oder Junge als ersten Akt nach der Geburt« (Tervooren 2006, 78). Bei Menschen, die Zugang zu Methoden der pränatalen »Geschlechtsbestimmung« haben, be ginnt die Zuschreibung u.U. sogar noch vor der Geburt. Obgleich biologische Prädispositionen, zum Beispiel hor monbildende Zellen oder Gene, keinen uneingeschränkten (geschlechtlichen) Determinismus bedeuten (vgl. Voß 2011, 139ff.; Butler 1991, 159ff.), wären hier Untersuchung in Bezug auf den oben erwähnten Embodiment-Ansatz interessant – welchen Einfluss haben solche Zuschreibungen auf die weitere (biologische) Entwicklung des Kindes?
19
Hartmann betont den dabei immanenten Zwang: Menschen würden »von der ersten Sekunde ihres Lebens an gezwungen […], auf eine spezifische Weise erwachsen zu werden« (Andrea Maihofer 2002: Geschlecht und Sozialisation, zit.n. Hartmann 2004, 31). Dem entgegen wird oftmals erst die Pubertät als leidvolle Phase hervorgehoben, da dort »die geschlechtlichen und sexuellen Identitätsfindungsprozesse […] für die Kinder und Jugendlichen […] starke Verunsicherungen« (Pohlkamp 2010, 48) verursachen. Die »problematische Phase« auf eine kurze Zeitspanne in der Jugend zu beschränken, wäre falsch. Vielmehr sei es der »Druck, sich geschlechtsidentisch anzupassen, [der] vielfach Leid verursacht« (ebd.). Dieser ständige Anpassungsprozess, der mit Ende der Pubertät keineswegs beginnt oder endet,38 sei »die eigentliche Katastrophe« (ebd., 49), doch dies werde von Pädagog_innen bislang nicht wahrgenommenen (vgl. ebd.). Diesem ständigen Anpassungszwang unterliegen dabei nicht nur bestimmte, sondern alle Menschen. Schließlich bewegen sie sich alle in der heterosexuellen Matrix, wo entsprechende Normen auf sie wirken – je nach Anpassungsvermögen oder -willen bekommt jede_r eine mehr oder eben weniger privilegierte soziale Position zugeteilt. Das heißt »Identitätskategorien haben niemals nur deskriptiven Charakter, sondern immer auch einen normativen und damit ausschließenden Charakter« ( Judith Butler 1993: Kontingente Grundlagen, zit.n. Stuve 2001, 287). Problematisch ist hierbei nicht, dass es Menschen gibt, die sich als heterosexuelle »Männer« oder »Frauen« verstehen. Allerdings muss es in einer emanzipatorischen Pädagogik darum gehen, eben jenen ausschließenden, zwanghaften und gewaltförmigen Charakter der Heteronormativität (vgl. Plößer 2005, 156f.) bzw. die Sanktionen für Devianz offenzulegen und in der eigenen Arbeit zu reflektieren und zu verändern.39 Damit ist klar, dass die heteronormative Matrix auf Menschen unabhängig davon wirkt, wie weit sie an die heteronormativen Ideale heranreichen oder davon abweichen – wenn auch in qualitativ sehr unterschiedlicher Weise (vgl. Nagel 2010, 251). Das heißt aber auch, dass eine »Aufweichung der Matrix […] einem Freiheitsgewinn für alle, nicht nur für trans- und intersexuelle Menschen, gleich[käme]« (ebd.). Auch Hartmann macht deutlich, dass »Grenzverwischungen nicht nur im 38 Butler zeigt auf, dass wir in Bezug auf unser Geschlecht ständig »geschult« werden: »[W] e are also educated into having a gender, which means that we get an education in gender before we arrive at any school. Indeed, in school, if we go to school, a gender education continues, which means that we become schooled in norms and conventions, that regulate gendered life.« (Butler 2012, 19). Die vor-schulische »gender education« wird unabhängig vom Lebensabschnitt immer weiterentwickelt: »[W]e might say that the first education becomes explicitly thematized in the second, and that the classroom, the school, and the university, all become ways in which we continue in a new way to reflect upon the conditions of our own formation.« (ebd.) 39 Wichtig ist es hierbei die Balance zu halten: Einerseits gilt es Nicht-Angepasste nicht als Opfer zu stilisieren und da mit zu entmündigen – es sind ja alle »betroffen«. Andererseits dürfen Machtungleichheiten auch nicht relativiert werden.
20
Blick auf besondere Subjektpositionen, wie beispielsweise die der Transsexualität, [sondern] vielmehr auch in Bezug auf alltägliche Interaktionen und Inszenierungen wahrzunehmen und damit auch die Dualität von Norm und Abweichung bzw. die von Norm und Subversion in Frage zu stellen« (Hartmann 2004, 22) sind. Sie plädiert dafür von der Vorstellung eines Randgruppenproblems abzurücken. Niemand reiche an das Idealbild »der Frau« oder »des Mannes« heran (vgl. Hartmann 2012, 158). Vielmehr sei die Identität von Brüchen und Abweichung gekennzeichnet: »Vielfältigkeit, Dynamik und Uneindeutigkeit finden wir auch innerhalb einzelner Menschen, in deren Beziehungen und Lebensläufe« (Hartmann 2004, 18). Wird sich für eine praktische Fruchtbarmachung der Queer Theory eingesetzt, ist gerade der fehlende Praxisbezug ein häufig formulierter Einwand. Der »vermeintlich fehlende[…] Handlungsbezug dieser [dekonstruktiven] Theorieansätze sowie in der in ihnen vertretenen Bewegung der Dezentrierung, die häufig als Antagonismus zu den auf Allgemeinheit und Einheit gerichteten erziehungswissenschaftlichen Hauptströmungen interpretiert wird« (Fritzsche et al. 2001b, 9), werden als Grund für die mangelnde Beschäftigung mit dem Thema genannt. Der Annahme, dass die Diskussion eine »rein theoretische sei« (Pohlkamp 2010, 50), widerspricht Pohlkamp. Sie hebt die queeren Kämpfe hervor, aus denen sich die queere Theorie speist, die im Alltag angesiedelt sind und ganz konkret Einfluss auf das Leben von Menschen haben. Und damit kommt sie zu folgendem Schluss: »Es ist somit kein theoretisches, sondern ein vor allem alltagsrelevantes und politisches Anliegen, die Subjektwerdung jenseits der Zweigeschlechtlichkeit anzuerkennen und damit eigene Bilder von Mädchen und Jungen zu revidieren und neue Räume zu eröffnen.« (ebd., 51 – Hervorh. J.S.)
Auch Hartmann sieht in einer kritischen und produktiven Beschäftigung mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten eine »lebenspraktische Relevanz« (Hartmann 2004, 18). Die Beschäftigung mit Queer Theory hat also durchaus einen Bezug zum Alltag und zur Praxis. Und so kehrt Hartmann den Vorwurf um: Es sind eher die Erziehungswissenschaften und die Pädagogik, die sich nicht mehr ausreichend an der Lebensrealität der Menschen zu orientieren: In Zeiten »abnehmende[r] Kontinuität und Kohärenz« (ebd., 19) müsse zudem zunehmend in Frage gestellt werden, warum in der Pädagogik auf »Allgemeinheit und Einheit« oder – in den Worten Hartmanns – »zeitüberdauernde und unverbrüchliche Identität« (ebd., 18) abgestellt werde. Die Pädagogik ist, wie beschrieben, bei der gewaltförmigen Durchsetzung einer heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit nicht unbeteiligt. Doch sowohl die Pädagogik wie auch die Erziehungswissenschaften sind auch fähig, die selbst (mit-)produzierte Wirklichkeit zu hinterfragen (Fritzsche et al. 21
2001b, 10). Und so bietet – wenn denn die Fähigkeit zur Selbstreflexion genutzt wird – der nicht geringe Anteil der Erziehungswissenschaften an der Reproduktion (gewaltvoller) Prozesse auch die Möglichkeit zur Veränderung eben dieser: »Wird Bildung als spezifische Weise begriffen, wie Subjektivität – verstanden als je spezifische Art und Weise, sich selbst zu verstehen und in der Welt zu sein – überhaupt erst angeregt und hervorgebracht wird, und erfolgt Vergeschlechtlichung über Subjektivierungsprozesse, dann wird nicht nur pädagogisches Handeln, dann werden auch erziehungswissenschaftliche Diskurse zu Orten des Bildungsgeschehens und damit zu Vektoren geschlechterregulierender Macht. Gleichzeitig eröffnet dies der Pädagogik die Chance, sich den Effekten des eigenen Tuns zuzuwenden, der Art und Weise, wie heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit in pädagogischen Diskursen implizit fortgeschrieben oder verschoben werden kann […].« (Hartmann 2012, 171 – Hervorh. J.S.)
III. Mädchen- und Jungenarbeit Im Folgenden werde ich die Geschichte der Mädchen- und der Jungenarbeit darlegen. Da die Entstehung dieser beiden pädagogischen Felder untrennbar miteinander verbunden ist, werde ich sie im Zusammenhang darstellen. Anschließend werden »traditionelle« Konzepte der Jungen- und Mädchenarbeit aus einer poststrukturalistischen Sicht kritisch beleuchtet. Vorweg sei festgehalten: Mädchenarbeit ist nicht gleich Mädchenarbeit (und Jungenarbeit ist nicht gleich Jungenarbeit). Das Spektrum reicht vielmehr von »konservativer, problemgruppenbeschreibender Mädchensozialarbeit bis hin zu einem radikalen feministischen Arbeitsansatz, der seine Wurzeln in der feministischen Analyse der Macht- und Herrschaftsstrukturen hat und daraus konsequente Handlungsstrategien ableitet« (Möhlke/Reiter 1995, 20). Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch auf der außerschulischen, feministischen40 Jungen- und Mädchenarbeit, wie sie insbesondere durch die »Heimvolkshochschule (HVHS) Alte Molkerei Frille« geprägt wurde.41 a. Entwicklung und Leitmotive der ( feministischen) Mädchen- und Jungenarbeit Die Jugendarbeit der Nachkriegszeit und den 1950ern war durchgehend »konservativ« (Klees et al. 1989, 12 – Hervorh. i. Orig.). Zum einen beförderte sie Geschlechterstereotype und patriarchale Verhältnisse (vgl. ebd.). Zum anderen wurden die Jugendlichen als von den Erwachsenen »zu formende, an die gesellschaftlichen Maßstäbe anzupassende Objekte« (ebd.) gesehen. Eigene Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen wurden dabei ignoriert (vgl. ebd.). Dabei richtete sich die Jugendarbeit fast vollständig auf männliche Jugendliche aus. In Bezug auf die Mädchen konstatieren Klees, Marburger und Schumacher schlicht: 40 Ich werde mich hauptsächlich auf feministische, nicht jedoch auf dezidiert oder unterschwellig antifeministischen ( Jungenarbeits-)Ansätzen sowie anti-emanzipatorische, konservative Konzepte beziehen, da ich in der feministischen Jungen- und Mädchenarbeit die noch fortschrittlichste Auseinandersetzung um Geschlecht und Geschlechterverhältnisse verwirklicht sehe. 41 Dort wurden die Modelle der antisexistischen Jungenarbeit und parteilichen Mädchenarbeit entwickelt (vgl. HVHS Alte Molkerei Frille 1989) an deren (weiterentwickelten) Grundsätzen sich bis heute vor allem feministisch-geprägte Pädagogik orientiert (Drogand-Strud/Rauw 2010, 278). Die Einrichtung schloss Ende des Jahres 2011.
22
»Als eigene Zielgruppe tauchen Mädchen nicht auf.« (ebd. – Hervorh. i. Orig.)
In den 1960er Jahren setzte »zwar das liberal-progressive Konzept der Jugendarbeit dem Objektverständnis ein Ende« (ebd.), gemischt-geschlechtliche Jugendarbeit blieb dennoch auf Jungen ausgerichtet (vgl. ebd.). In der »ausgelagerten« Bildungsarbeit speziell für Mädchen sollten diese zu der ihnen zugedachten späteren Rolle in der Gesellschaft erzogen werden: Sowohl in der Mädchenbildungsarbeit42, als auch in der »verbandlichen Mädchenbildung«43, wird das Dasein von »Frauen und Mädchen […] auf ein Leben für andere« (ebd., 13 – Hervorh. i. Orig.) reduziert. Gleichzeitig hatte sich in der BRD (in der DDR schon 194844) die koedukative Schulbildung durchgesetzt (vgl. Rendtorff 2006, 45f.), wobei das »alte (doch schon früher oft kritisierte) Schulsystem für Jungen als Maßstab und unveränderte Norm« (ebd., 46) beibehalten wurde. Anfang der 1970er Jahre entwickelten sich Ansätze, die als »emanzipatorisch«, »anti-kapitalistisch« oder »bedürfnis- und erfahrungsorientiert« deklariert wurden (vgl. Klees et al. 1989, 13). So fortschrittlich diese Entwicklungen zunächst waren, müssen alle drei Ansätze in Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse kritisiert werden: Sie »berücksichtigen geschlechtsspezifische Unterschiede nicht bzw. unzureichend oder erklären sie zu Nebenwidersprüchen, die sich mit der Aufhebung des Grundwiderspruchs von selbst lösen« (ebd.). Die Ursprünge der feministisch parteilichen Mädchenarbeit liegen in der neuen deutschen Frauenbewegung der 1970er Jahre (vgl. Behnisch/Bronner 2007, 25; Klees et al. 1989, 14). Diese wandte sich erstens gegen die bisherige Struktur und Praxis der Mädchen(bildungs)arbeit, zweitens kritisierte sie die Jugendarbeit allgemein für ihre »Jungenorientierung« und setzte sich schließlich drittens kritisch mit der Koedukation auseinander45 (vgl. ebd.). Klees, Marburger und Schumacher formulierten die Grundprämissen einer feministisch parteilichen Mädchenarbeit 1989 folgendermaßen: »Die feministische Mädchenarbeit […] versteht sich als eine für Mädchen und ihre Belange parteiliche. Sie geht davon aus, daß die Lebensrealität von Mädchen primär durch ihre Geschlechtszugehörigkeit bestimmt wird. Ihr zentrales Anliegen ist es, die Lebenssituation von Mädchen/Frauen zu verbessern. Sie setzt bei den Sozialisationsbedingungen und den daraus resultierenden Verhaltensmustern und Zukunftsvorstellungen an. Sie will Mädchen ermöglichen, in patriarchale Strukturen und ihre Wirkweisen Einsicht zu nehmen und sich ihrer bewußt zu werden, um sich aus ihnen zu befreien, sich zu behaupten und sich eine eigenständige Identität als Frau zu erarbeiten.« (ebd. – Hervorh. i. Orig.) 42 Diese sollte Mädchen auf ihr »frauenspezifisches« Erwachsenenleben vorbereiten. Angeboten wurden Kurse zu häuslichen »Fertigkeiten«, Ehe- und Familienleben, aber »immerhin« auch zu sozialen Berufen und »politischen« Themen (Klees et al. 1989, 12). 43 Die verbandliche Mädchenarbeit sollte »die Bildungsrückstände aufarbeiten und die Mädchen auf ihre zukünftigen Aufgaben, Lebens- und Handlungsfelder […] vorbereiten« (ebd., 13). 44 Diesbezüglich muss angemerkt werden, dass sich die folgenden Ausführungen in erster Linie auf den westdeutschen Kontext konzentrieren. 45 Die auf Jungen ausgerichtete Bildungsarbeit in Schulen und ein »›heimlicher Lehrplan‹« (Rendtorff 2006, 46) füh re zur Verdummung von Mädchen und stelle somit für diese eine »›Verführung zur Ohnmacht‹« (ebd.) dar.
23
Parteilichkeit gilt dabei als Mittel, das zur Erlangung von mehr Gerechtigkeit gegenüber Mädchen eingesetzt werden kann (vgl. Plößer 2005, 169). Dieses Handlungspostulates bedarf es – so fasst Plößer die Beweggründe zusammen – »weil die pädagogische Praxis ungerecht ist, weil in ihr die Bedürfnisse und Interessen von Mädchen ausgeblendet oder denen von Jungen untergeordnet werden« (ebd.). In den 1980er Jahren kam es »allmählich zur Etablierung und Institutionalisierung vieler Mädchenund Frauenprojekte sowie zu mehr Anerkennung von Mädchenarbeit in koedukativen Einrichtungen wie zum Beispiel in Jugendhäusern« (Behnisch/Bronner 2007, 27). Grund dafür war nicht zuletzt der Sechste Jugendbericht von 1984 (vgl. ebd., 26f.; Klees et al. 1989, 14f.). Dieser war für die Mädchenarbeit »insofern von Bedeutung, da eine Chancenungleichheit zwischen Mädchen und Jungen erstmals auf staatlicher und wissenschaftlicher Seite benannt wurde sowie empirische Befunde hierzu vorlagen« (Behnisch/Bronner 2007, 26). Dennoch waren es weniger staatliche Stellen als vielmehr Vertreterinnen der »autonomen Frauenbewegung«, die »Mädchentreffs, Zufluchtshäuser, Wohngruppen und Mädchenzentren […] bundesweit in vielen Städten« (Möhlke/Reiter 1995, 19) entstehen ließen. Gleichzeitig entwickelte sich innerhalb der »aktiven Szene« zunehmend Kritik an bisherigen Konzepten der Mädchenarbeit (vgl. Faulstich-Wieland 1995, 155; Behnisch/Bronner 2007, 27). Dabei wurde das ihnen zugrunde liegende, defizitäre Mädchenbild hinterfragt, das – so die Kritik – noch immer eine »männliche Normalbiographie« (ebd., 27) als Maßstab offenbarte. Neuere Konzepte setzten so fortan auf eine eigenständige »›Frauenkultur‹ und weibliche Bereiche« (Faulstich-Wieland 1995, 155), die einem differenz-feministischen Ansatz zugeordnet werden können. In den 1990er Jahren konnte sich die Mädchenarbeit zunehmend institutionalisieren: Mit neuen Gesetzen auf Bundesebene – wie im Bereich der Jugendarbeit das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) – wurde die Gleichberechtigungspolitik in den 1990er Jahren vorangetrieben, was den Weg dafür bereitete, dass sich die Mädchenarbeit auch in überregionalen Strukturen etablieren konnte (vgl. Behnisch/Bronner 2007, 27f.). Doch trotz der Expansion von Mädchenarbeit und dem zunehmenden Bewusstsein um die Geschlechterverhältnisse auch in Kreisen außerhalb autonomer Mädchenarbeitsgruppen, hielten die in der Mädchenarbeit tätigen Pädagog_innen den Vorwurf »Jugendarbeit ist Jungenarbeit« 1995 noch für berechtigt (vgl. Möhlke/Reiter 1995, 11). Dass trotz der Expansionsphase der Zustand der Mädchenarbeitseinrichtungen und -projekte in den 2000er Jahren als wieder (bzw. noch immer) prekär einzustufen war, war in erster Linie dem »enormen Sparzwang« (Behnisch/Bronner 2007, 28) in sozialen Einrichtungen zuzuschreiben.
24
Die pädagogische Arbeit mit Jungen hat eine ungleich längere Geschichte als die mit Mädchen. Bereits im Begriff »Pädagogik« selbst, übersetzt mit der »Lehre der Knabenführung«, ist der Adressat männlich definiert (vgl. ebd., 132). Überspitzt könnte man sagen, Erziehung und Bildung in der »westlichen Welt« kam fast ausschließlich Jungen zu Gute. Dass aus »der geschlechtsspezifisch weitgehend unreflektierten ›Arbeit mit Jungen‹ […] die ›Jungenarbeit‹« (ebd., 133) wurde, war zum einen das Resultat der Frauenbewegung bzw. der Ruf der Mädchenarbeit_innen danach (vgl. Faulstich-Wieland 1995, 159) und zum anderen das Ergebnis einer »kritisch-selbstreflexiven Männerbewegung« (Behnisch/Bronner 2007, 133). Zum einen war die Forderung von Mädchenarbeiter_innen nach einer Jungenarbeit wegen ganz praktischer Probleme aufgekommen: Die Pädagog_innen sahen sich in der Frühphase der Mädchenarbeit damit konfrontiert, dass ihre Arbeit mit den Mädchen von Männern bzw. Jungen blockiert wurde (vgl. Faulstich-Wieland 1995, 159). Zum anderen wird angegeben, auslösend sei die »Erfahrung [gewesen], dass das traditionelle Männerbild nicht mehr mit der Realität korrelierte und dass den Jungen überzeugende und praktikable Männerkonzepte fehlten« (Fuhr/Schultheis 2006, 30). Dies führte zu der Erkenntnis, dass eine Arbeit mit den Mädchen nicht ohne Blick auf die Jungen funktionieren könne. Und so wurde »gleichzeitig mit dem Beginn der parteilichen Mädchengruppenarbeit« (Hoffmann 1994, 102) im Jahre 1977 der Aufbau von Jungengruppen gefordert, »um den Schwierigkeiten der Jungen unter Anbetracht der Mädchengruppe gerecht zu werden« (Monika Savier/Carola Wild 1983: Mädchen zwischen Anpassung und Widerstand, zit.n. Hoffmann 1994, 102). Berno Hoffmann spricht in diesem Zusammenhang (mit kritischem Unterton) von der »Geburt der ›Jungenarbeit‹ aus dem Schoße des Feminismus« (Hoffmann 1994, 102). Entsprechend seinem Entstehungsumfeld wurde mit Beginn der 1980er Jahre die »pädagogische Arbeit mit Jungen als eine reflektierte, kritische und bewusste Pädagogik entworfen« (Behnisch/Bronner 2007, 132f.). Hannelore Faulstich-Wieland beschreibt den Beginn der Jungenarbeit wie folgt: »Anfangs/Mitte der 80er Jahre begannen dann Pädagogen in der Jugendarbeit, sich der Aufgabe anzunehmen, mit Jungen an deren Männlichkeitskonzepten zu arbeiten. 1985 starteten in der Heimvolkshochschule Frille Elisabeth Glücks und Franz-Gerd Ottemeier-Glücks das meines Wissens erste Modellprojekt, das beide Bereiche der Jugendarbeit umfaßte: ›Was Hänschen nicht lernt … verändert Klara nimmer mehr: Parteiliche Mädchenarbeit – antisexistische Jungenarbeit‹ […].« (Faulstich-Wieland 1995, 159)
Jener in der HVHS Frille entworfene Ansatz einer antisexistischen Jungenarbeit hatte den »Status des Pioniercharakters« (Behnisch/Bronner 2007, 133) und »orientiert sich […] stark an einer feministischen Deutung« (ebd.). Letzterem entsprechend wurden Jungen »positive Perspektiven einer Veränderung ihres Machtanspruchs [angeboten] […], die vor allem in praktischen und emotionalen Reproduktionsleistungen sowie dem Abbau von Konkurrenz bestehen« (ebd., 134). 25
In den Folgejahren erwies sich das Friller Konzept als »wahre[…] Triebfeder der Weiterentwicklung von Jungenarbeit« (ebd., 134f.). Das Konzept erfuhr einerseits große Beachtung, aber auch viel Kritik: Ihm läge eine einseitige Sicht auf Jungen zugrunde, es bliebe »einem permanenten Opfer-TäterSchema verhaftet« (ebd.), stünde einzig im Dienste einer feministischen Mädchenarbeit und trage schon im Namen eine »stigmatisierende Begrifflichkeit« (ebd., 134). Die kontrovers geführten Diskussionen sensibilisierten bzw. politisierten viele männliche Pädagog_innen, sodass die Jungenarbeit in den 1990er Jahren einen »Boom« erlebte (vgl. ebd., 135). In Auseinandersetzung mit der Kritik und unter Einfluss von Foucaults Machtbegriff (vgl. Bentheim et al. 2004, 98) gewannen Jungenarbeitsansätze an Einfluss, die nicht mehr vom Status des ausschließlichen Täters ausgingen, sondern auch die gesellschaftlichen Zumutungen46 anerkannten, denen Jungen ausgesetzt waren bzw. sind (vgl. Behnisch/Bronner 2007, 135). Mit dem Konzept der »hegemonialen Männlichkeit«47 von R. Connell lassen sich diese »gesellschaftlichen Zumutungen« letztlich auch als Ausdruck einer patriarchalen Gesellschaft sehen (vgl. Bentheim et al. 2004, 109; Blomberg 2003, 9f.). Einige Formen der Jungenarbeit orientierten (vgl. Karl 1996) bzw. orien tieren (vgl. Busche 2010; Busche/Cremers 2010) sich daher weiterhin an feministischen, patriarchatskritischen und antisexistischen Praxen und legen ihren Fokus auf Machtverhältnisse (vgl. Bentheim et al. 2004, 107ff.). Es wäre falsch alle anderen Ansätze, wie beispielsweise die »kritische« oder auch identitätsorientierte Jungenarbeit von Reinhard Winter und Lothar Böhnisch oder die »emanzipatorische« Jungenarbeit wie die von Michael Schenk als vollkommen unreflektiert abzutun oder gar mit einer dezidiert antifeministischen, maskulinistischen Jungenarbeit beispielsweise von Robert Bly gleichzusetzen (vgl. ebd., 97; Stuve 2001, 283). Und dennoch kann ihnen – wenn auch in unterschiedlicher Qualität – eine mangelnde Berücksichtigung von strukturellen Ungleichheiten angelastet werden. Die Diskussion veränderte sich nochmals mit der Veröffentlichung der PISA-Untersuchungen im Jahr 2000 und der sich daran anschließenden breiten öffentlichen Debatte (vgl. Behnisch/Bronner 46 Zu den Grundlagen der antisexistischen Jungenarbeit gehöre einerseits – so schreibt der in der HVHS Frille tätige Pädagoge Karl Holger 1996 – zu erkennen, dass Jungen Probleme machen (vgl. Karl 1996, 138ff.). Andererseits müsse aber auch erkannt werden, dass sie durchaus Probleme haben: So schreibt er, dass Jungen bei ihrer Sozialisation ver mehrt auf sich alleine gestellt seien und es an positiven Identifikationsfiguren mangele (vgl. ebd., 134f.). Jungen müs sen sich zudem ständig als überlegen, souverän und schmerzunempfindlich inszenieren (vgl. ebd., 135f.), seien zur Rastlosigkeit gezwungen und auf der »Flucht vor Selbstwahrnehmung« (ebd.). Ihren Körper verstünden sie als »Maschine« (ebd., 137), die es störungsfrei zu beherrschen gelte oder andernfalls dazu zu unterwerfen gelte. Eine la tente und doch allgegenwärtige Homophobie lasse keine Zärtlichkeiten unter »Geschlechtsgenossen« zu und ver hindere jeglichen »freundlichen körperlichen Umgang miteinander« (ebd., 137). Diesen Zumutungen ausgesetzt, entstünden »partiell lebensuntüchtige, ›halbe‹ Menschen« (ebd., 138), die nicht in der Lage sind, »für sich und an dere zu sorgen« (ebd.). 47 Für eine kritische Betrachtung des Konzeptes der hegemonialen Männlichkeit bzw. seiner Rezeption, siehe den Text »›Hegemoniale Männlichkeit‹ – Innovatives Konzept oder Leerformel?« von Sylka Scholz (vgl. Scholz 2004).
26
2007, 138). Es entwickelte sich ein bis heute hegemonialer Diskurs, in dem Jungen als »Bildungsverlierer« gesehen wurden. Als Grund wird oftmals eine »Feminisierung von Schule« bzw. von »Erziehungssituationen« allgemein angenommen, die dazu führe, dass Jungen ohne (positive) männliche Vorbilder aufwachsen müssten und in der Konsequenz schlechtere schulische Leistungen erbringen könnten (vgl. Budde 2009, 74ff.).48 Im Gegensatz zur feministisch motivierten Jungenarbeit spielte hierbei die Kritik an den »Zumutungen« patriarchaler Gesellschaften keine Rolle. Vielmehr kann die Debatte als Rollback verstanden werden, mit der die Markt- bzw. Wettbewerbsfähigkeit der Bildungsbiographien von Jungen in den Vordergrund gestellt wurden. Vor allem von feministischer Seite wird unter anderem kritisiert, dass nicht der gesamte Bildungssektor in den Blick genommen wurde bzw. wird.49 Letztlich führten die Diskussionen zu einer weiteren Institutionalisierung von Jungenarbeit (vgl. Behnisch/Bronner 2007, 137f.), nicht selten auf Kosten von bereits etablierten Mädchenarbeitsprojekten (vgl. Maikowski/Wesemüller 2010, 298f.). Mädchen- und Jungenarbeit will stereotype, einschränkende Geschlechterrollen, die den jeweiligen Geschlechtern zugeschrieben werden, aufbrechen und Jungen und Mädchen zu alternativen Bildern und (Selbst-)Bewertungen ihres eigenen und des anderen Geschlechts abseits patriarchaler Normen verhelfen (vgl. Möhlke/Reiter 1995, 25; Stuve 2001, 285.). Während also soziale Zuschreibungen qua Geschlecht aufgehoben werden sollen, gehen die meisten Konzepte der Jungen- und Mädchenarbeit im Kern noch immer von zwei – und nur zwei – Geschlechtern aus, die klar voneinander zu unterscheiden seien. So umreißt Rendtorff die (parteiliche) Mädchen- und (antisexistische) Jungenarbeit als »getrennte, aber gleichermaßen parteiliche Bildungsangebote für Jungen und Mädchen […], die die Besonderheiten ihrer gesellschaftlichen Rolle und ihrer geschlechtstypischen psychosexuellen Entwicklung berücksichtigen sollten« (Rendtorff 2006, 52). Eine solche Pädagogik soll demnach die Rollen, die Frauen und Männer in der Gesellschaft einnehmen (sollen), als auch die (unterstellte) unterschiedliche Entwicklung von Psyche und Körper, einbeziehen.50 Einige ( Jungenarbeits-)Ansätze 48 Gegen mehr Männer im care-Bereich spricht an und für sich nichts. Dem gängigen Vorschlag, einer vermeintlichen »Feminisierung von Schule« mit mehr männlichem Personal im Erziehungsbereich entgegen wirken zu müssen, sehe ich mit Faulstich-Wieland allerdings sehr skeptisch (vgl. Faulstich-Wieland 2011). 49 Für eine ausführlichere und – wie ich finde – notwendige Kritik an der bisweilen klar antifeministischen Diskussion um »Jungen als Bildungsverlierer« sei auf den Text »Geschlecht und Bildungserfolg – Eine Analyse aus der Perspektive der Feminist Theory« von Becky Francis und Christine Skelton verwiesen (vgl. Francis/Skelton 2011, 388f.). 50 Bei den »gesellschaftlichen Rollen« wird die Gebärfähigkeit und damit das »(Nicht-)Mutter-Sein« als wesentlicher Grund dafür genannt, Jungen und Mädchen unterschiedlich auf eben jene Rollen vorzubereiten (vgl. Stuve 2001, 282f.). Es wird dabei Weiblichkeit untrennbar mit Mütterlichkeit konnotiert. Dass es Frauen gibt, die keine Kinder haben möchten oder keine bekommen können, weicht diese Weiblichkeit-Mutter-Unität allerdings schon wieder auf. Zugleich lässt sich (zumindest bedingt) eine Veränderung von Vaterschaften bzw. Familienmodellen beobachten (vgl. Tuider/Huxel 2010). »Heute wie damals« unterscheiden sich je nach Region und Klasse Geschlecht und die damit verbundenen Rollen (vgl. Bock/Duden 1977). Eine erwerbstätige, alleinerziehende Mutter müsste anders auf ihre
27
betonen zwar die Parteilichkeit weniger (vgl. Bentheim et al. 2004). Dennoch lassen sich die Spezifika einer vor allem feministischen Mädchen- und Jungenarbeit als parteilich, in geschlechterhomogenen Gruppen arbeitend und die geschlechtsspezifischen Lebensrealitäten berücksichtigend zusammenfassen. b. Relikte und Konflikte – Kritik an heteronormativer Mädchen- und Jungenarbeit Die Begründung einer Mädchen- und Jungenarbeit war, wie erwähnt, vor dem Hintergrund des konservativen deutschen Bildungssystems und der androzentrischen Jugendarbeit zunächst ein begrüßenswerter Fortschritt. Doch muss gefragt werden, ob die Mädchen- und Jungenarbeit heute noch das »zeitgemäße« Instrument zur Veränderung von Geschlechterverhältnissen ist.51 Die praktischen wie theoretischen Konzepte haben sich zwar mancherorts gewandelt: Es wird mittlerweile das Wissen über die Heterogenität innerhalb der Geschlechterkategorien Mann und Frau berücksichtigt, das spätestens durch die Werke von Schwarzen Autor_innen wie Kimberlé W. Crenshaws »Mapping the Margins« von 1991 und mit Connells Buch »Masculinities« von 1995 sowie der Intersektionalitätsforschung etabliert wurde (vgl. Blomberg 2003, 12f.). Auch wurde größtenteils – trotz der zeitweisen Tendenzen einer »Besinnung auf das genuin Weibliche« bzw. antifeministisch-maskulinistischen Bewegungen52 – mit starren Geschlechterrollen(-klischees) gebrochen. Beherzigt man allerdings eine Sicht auf Geschlecht und Sexualität wie sie die Queer Theory hervorgebracht hat, findet ein wesentlicher Schritt derzeit nicht statt: Es wird allzu wenig darüber reflektiert, wie eine Mädchen- und Jungenarbeit Dualismen (re-)produziert, essentialistisch und (auch deswegen) normierend bzw. ausschließend ist. Damit steht die Mädchen- und Jungenarbeit in Konflikt mit queeren Ansätzen. Nachfolgend soll gezeigt werden, dass nicht zuletzt die »Prinzipien« der (heteronormativen) Mädchen- und Jungenarbeit53 – Parteilichkeit, »geschlechtshomogene« Gruppenarbeit und der Bezug Rolle als »Mutter« vorbereitet werden, als eine lesbische Mutter in einer Mehr-Generationen-Familie mit hohem Einkommen – die Mutterrolle kann also weder das »breite Spektrum an Müttern« und schon gar nicht das aller Frauen abdecken. 51 Eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse ist also noch immer nötig. Ich frage dies daher nicht – wie im Laufe dieser Arbeit hoffentlich ersichtlich wurde – um dem Diskurs Raum zu geben, der (fälschlicherweise) behauptet, Mädchen bzw. Frauen seien Jungen bzw. Männern nach Jahren der Gleichstellungspolitik längst ebenbürtig und be sonders die Mädchen bzw. Frauen benötigen keinerlei weitere Förderung. 52 Bei Teilen der differenzfeministischen Ansätze muss – bei all ihrer wichtigen Kritik an der systematischen Abwertung von Weiblichkeit und »weiblichen Eigenschaften« auch innerhalb des Feminismus – auf die Gefahr einer Verfestigung traditioneller Geschlechterrollen hingewiesen werden (vgl. von Felden 2003, 86; ebd., 89). Bei den maskulinis tischen Teilen der Männerbewegung wird eine »Rückkehr« zu bzw. Orientierung an »überzeitlichen« männlichen Archetypen wie dem – so der Titel eines Buches von Robert L. Moore und Douglas Gillette von 1992 – »König, Krieger, Magier, Liebhaber« explizit gefordert (vgl. Blomberg 2003, 7f.). 53 Die Betonung der Heteronormativität erfolgt deshalb, da es auch Ansätze gibt, die sich nach wie vor als Mädchenbzw. Jungenarbeit bezeichnen und sich damit bewusst der Paradoxie zu stellen, erst aufgreifen zu wollen, was sie eigentlich dekonstruieren wollen und dabei versuchen nicht-heteronormativ zu sein (siehe Kapitel IV a). In diesem Kapitel wird meist pauschal von »Mädchen- und Jungenarbeit« gesprochen, aber »heteronormative Mädchen- und
28
auf »geschlechtsspezifische Lebensrealitäten« – zu einer Verfestigung der heterosexuellen Matrix führen. In pädagogischen Zusammenhängen wird der »Erwerb von Identität in Form einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Anderen« (Tuider 2004, 181) in aller Regel befördert – dies ist auch in der Jungen- und Mädchenarbeit der Fall (vgl. Nagel 2010, 252ff.). Dem Identitätserwerb wird also ein »Modell der eindeutigen Dichotomie von Ich/Anderer […] zugrunde gelegt« (Tuider 2004, 181). Die Wichtigkeit der Dichotomie für die Subjektkonstitution hebt Stuve hervor: »Die Dichotomie stellt ein Werkzeug zur Organisierung von Wahrnehmung und Erfahrung dar, mit dessen Hilfe das Eigene und das Andere mit den je spezifischen Eigenschaftsmustern konstituiert wird.« (Stuve 2001, 287)
Wie bereits gezeigt wurde, gehen mit einem Denken in Dichotomien Ausschließungen, Normierungen und Hierarchisierungen einher. Im Falle der Zweigeschlechtlichkeit ist dies erstens eine Ausschließung von Menschen außerhalb des binären Rahmens: Durch die Nicht-Benennung von Transgendern54 wird Mann- und Frau-Sein als Norm gesetzt, dem sich »alles andere« unterzuordnen und anzupassen hat. Die Hierarchie verläuft hier zunächst klar zwischen »normalen Geschlechtern« und Transgendern zuungunsten letzterer. Schließlich kommt es jedoch zweitens auch zu einer Hierarchisierung zwischen den beiden »normalen« Geschlechtern. Bereits Simone de Beauvoir hat 1949 in ihrem Werk »Das andere Geschlecht« gezeigt, wie zur Herstellung des »männlichen Eigenen« eine Abgrenzung zum »weiblichen Anderen« benötigt wird (vgl. de Beauvoir 1999, 12ff.). Die Andersartigkeit des Anderen ist Grundlage für jegliche Diskriminierung (vgl. ebd., 13). Bestehende Machtungleichheiten und Dominanzdiskurse bewirken eine Abwertung des »Anderen« – in diesem Fall ist es die patriarchale Ausrichtung der Gesellschaft an »männlichen Idealen« die zu einer Herabwürdigung Frauen bzw. »dem Weiblichem« führt (vgl. ebd., 190).55 Anstatt Kategorien bzw. Identitäten grundsätzlich als veränderlich und offen hervorzuheben, rekurriert die Mädchen- und Jungenarbeit jedoch bereits mit ihrer Bezeichnung auf Geschlecht (und Sexualität) als »dichotom organisierte Strukturkategorien« (Hartmann 2004, 18), indem nur zwei Jungenarbeit« gemeint. 54 Pohlkamp fasst mit dem Begriff Transgender »alle Personen, für die alltäglich entweder eine geschlechtliche Klassifi zierung nicht möglich oder nicht gewünscht ist« (Pohlkamp 2010, 39). Darunter fallen ihrer Ansicht nach IntersexPersonen genauso wie Transsexuelle oder »Part-Time«-Crossdresser_innen mit (vermeintlich) eindeutiger und kohärenter Geschlechtsidentität (vgl. ebd.). 55 Der Begriff Othering zeigt dieses Phänomen des Abgrenzens und Selbststilisierens vorrangig im Kontext von Kultu ren. Der Begriff wurde durch Edward Saids Werk Orientalism 1978 geprägt und findet vor allem Verwendung im Feld der postkolonialen Studien. Othering beschreibt »den Prozess des Fremd-Machens, bei dem nicht nur die Anderen geschaffen, sondern darüber hinaus auf eine Position der Nicht-Zugehörigkeit festgelegt werden« (Castro Vare la/Mecheril 2010, 99). Gleichzeitig geht mit dem Fremd-Machen immer eine Homogenisierung des »Eigenen« in Abgrenzung zum »Anderen« einher (vgl. ebd.).
29
Geschlechter angesprochen werden. Pohlkamp merkt mit Bezug auf Butler an, »[a]llein der Bezug auf die Kategorie Frau (Mädchen) […] sei ein Rekurs auf die hegemoniale Zweigeschlechtlichkeit und verstärke, was zu demontieren sei: die Dualität und die Hierarchie der Dualität von (nur) zwei Geschlechtern« (Pohlkamp 2010, 38). Schon in der Bezeichnung »Mädchenarbeit« (bzw. »Jungenarbeit«) äußert sich also die Setzung von Zweigeschlechtlichkeit als Norm, womit keine Uneindeutigkeiten zugelassen werden (vgl. ebd., 41). Queer Theory hat die ausschließenden Mechanismen, die mit einem Denken in Dualismen einhergehen, beschrieben. Deswegen sind pädagogische Ansätze, die auf die binäre Aufteilung von Kategorien bestehen oder gar darauf gegründet sind, aus queertheoretischer Sicht problematisch.56 Will man Ausschließungen verhindern, muss also das Denken in Binaritäten aufhören. Im konkreten Fall der Abwertung von Frauen und Weiblichkeit hieße das: Die bestehende Hierarchisierung zwischen »den beiden Geschlechtern« zugunsten des Mannes kann nur aufgehoben werden, wenn die Dichotomie Mann/Frau ihrerseits aufgehoben wird. Da dieser Zusammenhang – Stuve zeigt dies sowohl für Konzepte der identitätsorientierten als auch solchen der antisexistischen Jungenarbeit – in der Regel nicht erkannt wird, können solche Konzepte zwar Verbesserungen erwirken, müssen aber in letzter Konsequenz scheitern: »Beide […] Ansätze der Jungenarbeit stellen sicher eine faktische Irritation der bestehenden Männlichkeit(en) dar, da sie an der Vervielfältigung von Identifikationsmöglichkeiten beteiligt sind. Doch stehen sie sich letztlich selbst im Wege, indem sie mit dem Bild des neuen Jungeseins/Mannseins dazu tendieren, wieder zu vereindeutigen und zu vereinheitlichen, was sie zuvor dezentriert und diversifiziert haben.« (Stuve 2001, 285)
Die Arbeit mit »geschlechterhomogenen« Gruppen muss ebenfalls für den darin angelegten Gedanken der Zweigeschlechtlichkeit, jedoch auch für einen (meist) latenten Essentialismus und dem damit einhergehenden Ausschluss von Uneindeutigkeiten kritisiert werden. Jungen- und Mädchenarbeit findet nahezu ausschließlich in »geschlechterhomogenen« Gruppen statt. Wem wird nun aber Zugang zu welcher Gruppe gewährt? Um eine »gemischtgeschlechtliche« Gruppe in (nur) Mädchen und Jungen aufzuteilen, müssen sich »Maßstäbe« finden, anhand derer die Entscheidung getroffen wird. Letztlich geschieht dies anhand des biologischen Geschlechts, das meist an den (angenommenen) primären Sexualorganen festgemacht wird (vgl. Pohlkamp 2010, 54).57 Mit dem Pro56 Konsequenterweise muss so auch eine Pädagogik abgelehnt werden, die lediglich die Anerkennung des »Anderen« einfordert, ohne die Aufteilung in »Ich« (bzw. »Wir«) und »Andere« an sich zu problematisieren. Für eine vergleichsweise ausführliche Kritik derart problematischer Ansätze aus queerer Perspektive (die stellvertretend an Anne dore Prengels »Pädagogik der Vielfalt« und Barbara Rendtorffs Forderung nach der »Anerkennung der Differenz« vorgenommen wird) sei auf den Text »Geschlechtertransformationen« von Gesa Heinrichs verwiesen (Heinrichs 2002, 158ff.). 57 Bei der Frage nach dem Vorhandensein entsprechender primärer Sexualorgane wird in der Praxis in den allermeisten Fällen auch nur auf Erscheinung, Name und Verhalten geschlossen. Das wirkt progressiv, da sich hier auf das performativ-inszenierte Geschlecht bezogen wird, ist es aber letztlich nur scheinbar: Schließlich verlässt man sich auf die ge schlechtliche Inszenierung nur aufgrund der Nicht-In-Frage-Stellung der Kohärenz von sex, gender und desire.
30
zess der Aufteilung einer »gemischtgeschlechtlichen« Gruppe in Jungen und Mädchen wird zum einen nochmals die Norm der Zweigeschlechtlichkeit betont, zum anderen werden Kinder aufgrund eines vermeintlich »wahren Geschlechtskerns« einer der beiden Gruppen zugeordnet. Stuve kritisiert die Jungenarbeit dafür, die Auffassung von männlicher Identität als etwas, das mit dem JungeSein »einfach da ist« (und damit natürlich erscheint), »weitestgehend unhinterfragt übernommen« (Stuve 2001, 286) zu haben. Jungenarbeit folge damit einem »sex-gender-Determinismus« (ebd. – Hervorh. i. Orig.). Auch Hartmann kritisiert am Beispiel eines Konzeptes lesbisch-feministischer Mädchenarbeit die essentialistischen Tendenzen bzw. die »substanziellen, vorsozialen Identitätsvorstellungen« (Hartmann 2001, 71). Kritikwürdig ist ein solcher Essentialismus nicht zuletzt deshalb, da er einen »Zwang zur Vereindeutigung« (ebd., 72) und Verfestigung von Identitäten darstellt bzw. »den Druck [forciert], die eigene Lebensgeschichte konsistent zu erzählen« (ebd.). Drogand-Strud und Rauw zeigen weitere Kritikpunkte an der Arbeit mit »geschlechtshomogenen« Gruppen auf: »[E]s gibt keinen Raum für Uneindeutigkeiten zwischen den Geschlechtern, intersexuelle Menschen werden ausgegrenzt, es gibt keine gemeinsame Debatte über die Wirkungsmacht der Kategorie Geschlecht und anderer Kategorien, die Bilder über das ›andere‹ Geschlecht können nicht überprüft werden und ein gemeinsames Erarbeiten einer inhaltlichen Plattform für geschlechtsbezogene Pädagogik findet nicht statt« (Drogand-Strud/Rauw 2010, 274).
Neben der Reifizierung der Zweigeschlechtlichkeit wird laut Howald in der Mädchenarbeit Heterosexualität als Norm gesetzt. Die Art und Weise, »wie Sexualität in den Diskursen der feministischen Mädchenarbeit verhandelt« (Howald 2001, 300) werde, finde verdeckt unter der Prämisse der Heterosexualität statt. (vgl. ebd., 295): In der Theorie wie in der Praxis der Mädchenarbeit werde durch die dort übliche Nicht-Thematisierung von Sexualität im Allgemeinen, Heterosexualität als Norm weiter stabilisiert, was sich »beschränkend für die Entwicklung aller Mädchen«58 (ebd., 302 – Hervorh. J.S.) auswirke. Den allgemein ausschließenden Charakter der ( Jungen- und) Mädchenarbeit betont Pohlkamp. Sie bezeichnet die Mädchenarbeit als ein »originär transphobes59 Feld« (ebd., 41), in der Geschlechter abseits der Norm ausgeblendet werden: 58 Howald betont damit in Bezug auf die Mädchen- und Jungenarbeit, was schon an anderer Stelle für die Pädagogik und Erziehungswissenschaften allgemein geäußert wurde: Betroffen sind nicht nur die als »abweichend« Markierten, sondern alle. Howald fordert daher auch die Beteiligung aller an der Problemlösung und kritisiert die Tendenz der Pädagogik Probleme in Nischen, beispielsweise in eigenständige Projekte für die entsprechende Minderheit, abzu schieben (vgl. Howald 2001, 303). 59 Pohlkamp meint hier nicht eine Feindlichkeit gegenüber Transsexuellen, sondern gegenüber allen »geschlechtlich unangepassten« Personen (vgl. Pohlkamp 2010, 40).
31
»Transgender Jugendliche tauchen in der Diskussion um (geschlechterreflektierende) Pädagogik […] nicht auf; sie bekommen keine rechtliche oder politische Stimme.« (ebd., 40)
Anders gesagt: »Transgender ist bislang kein Thema in der Mädchen- und Jungenarbeit.« (Pohlkamp 2010, 37)
Es bleibt demnach festzuhalten, dass Trans- und Intersexuelle von der Jungen- und Mädchenarbeit ausgeblendet werden, während zugleich (mögliche60) Transgender unsichtbar gemacht werden. Auch in Hinblick auf das Postulat der Parteilichkeit ergeben sich aus queerer Perspektive mehrere Probleme. Parteilichkeit war einer der genannten Grundsätze vor allem der Mädchen- (vgl. Klees et al. 1989, 35ff.), jedoch auch der Jungenarbeit (vgl. Karl 1996, 147). Plößer nimmt eine dekonstruktive Relektüre des Parteilichkeitsprinzips der feministischen Pädagogik vor, wobei ihr Fokus auf der Parteilichkeit in der Mädchenarbeit liegt. Dabei macht sie grundlegende Widersprüche deutlich, die sich daraus ergeben. So werden in der Parteilichkeit Effekte mit Ursachen verwechselt: Eine »›(gemeinsame) weibliche Geschlechtsidentität‹« (Plößer 2005, 171) wird als Grundlage für die Parteilichkeit postuliert. Allerdings sind die für eine Parteilichkeit notwendigen Parteien, die Mädchen und die Mädchenarbeiter_innen bzw. deren Bedürfnisse und Interessen, nicht per se da, sondern sind vielmehr »performative Effekte« (ebd.) jener Annahme der gemeinsamen Geschlechtsidentität. Das heißt, die eigentlich zunächst nur angenommene Weiblichkeit bzw. weibliche Identität wird »zur Ursache umgedeutet« (ebd., 172) und als (unhaltbare) Letztbegründung angeführt. Will man sich also nicht auf eine falsche und eigentlich fehlende »prädiskursive« Grundlage einlassen, muss eine Parteilichkeit folglich »unbegründbar« bleiben. Um sich »gegenüber einem Anderen als solidarisch oder verantwortlich [also parteilich] erweisen zu können, braucht es die nicht-einholbare Andersheit der Anderen« (ebd., 173), die damit aber erst hergestellt wird. Gleichzeitig wird es notwendig diese Andersheit anzuerkennen (womit sie abermals reifiziert wird). Denn schließlich muss »jeder Versuch, dem Anderen in einem pädagogischen Kontext Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, eine Form der Anerkennung des Anderen leisten« (Plößer 2005, 174). Plößer kommt zu folgendem Schluss: »Dadurch, dass die weibliche Geschlechtsidentität als Grund und damit als repräsentier- und verantwortbare Einheit imaginiert wird, werden die Grenzen des Parteilichkeitsanspruchs und damit sein notwendiges Scheitern ausgeblendet.« (ebd., 178)
Neben diesen Widersprüchen zeigt Plößer in Anschluss an Jacques Derrida, dass die feministische Pädagogik ihre Parteilichkeitsregel zugunsten einer »Nicht-Entscheidbarkeit« verändern muss. An60 Es sei nochmals daran erinnert, dass die heteronormativen Diskurse nicht nur biologisch keinem der »beiden Geschlechter« zuzuordnenden Menschen ausschließen, sondern auch geschlechtlich vermeintlich »eindeutige« Men schen massiv einschränken.
32
sonsten wendet sie eine bloße mechanische Regel an, die ihr Ziel – ein Mehr an Gerechtigkeit – trotz Ermöglichung partieller Verbesserungen letztlich verfehlen muss und damit ihren »moralischen Anspruch« verliert (vgl. ebd., 176ff.). Denn »[d]arf die Antwort nur den Mädchen gelten, wird die [nach Derrida] für die Verantwortung unumgängliche Anwesenheit einer anderen Subjektposition und damit die Möglichkeit einer anderen Antwort ausgeklammert« (ebd., 177 –Hervorh. i. Orig.). Anders ausgedrückt: »Bleibt die Forderung der Parteilichkeit an die Geschlechtsidentität der Mädchen und der Pädagoginnen gebunden, kann sich die mit dem Postulat intendierte Gerechtigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen gerade nicht ereignen.« (ebd.)
Es lässt sich zusammenfassen, dass zum einen im Parteilichkeitsprinzip essentialistisches Denken angelegt ist. Zum anderen wird mit der Parteilichkeit an der Aufrechterhaltung einer Pathologisierung von marginalisierten Gruppen in Form ihrer ständigen Anrufung als »Andere« gearbeitet, womit Hierarchisierungen begünstigt werden. Trotz alledem wurde angedeutet, dass das Parteilichkeitsprinzip auf eine dekonstruktive Weise weiterentwickelt werden könnte, was im kommenden Kapitel kurz aufgegriffen wird. Die Jungen- und Mädchenarbeit bzw. ihre impliziten Annahmen und Praxen sind, wie dargestellt wurde, aus queerer Sicht höchst problematisch. Sie verstärken ein Denken in Dichotomien, befördern die Norm von Zweigeschlechtlichkeit bzw. Heteronormativität und rekurrieren auf eine jeweilige »Essenz«, die Frau- und Mann-Sein zugrunde liegt und leiten daraus Besonderheiten ab, auf die in den »geschlechterhomogenen« Gruppen jeweils eingegangen werden soll. Die Mädchen- und Jungenarbeit ist »angetreten« um Ausschließungen und Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Doch zeigt sich, dass sie gleichzeitig andere Hierarchisierungen und Ausschließungen produzieren bzw. durch ihr In-Kauf-Nehmen begünstigen. Plößer warnt davor, dass – sofern dekonstruktive Theorien weiterhin keinen Eingang in die pädagogische Praxis finden – die »eigenen (feministisch-pädagogischen) Gewaltförmigkeiten im Umgang mit der Geschlechterdifferenz unkritisiert und unhinterfragt mitgenommen werden« (ebd., 13) und zugleich die Chance vertan werde, »nach alternativen und gewaltmindernden Umgangsweisen mit der Differenz zu suchen« (ebd.). Mädchen- wie Jungenarbeit darf sich also nicht weiter queeren Ansätzen verschließen. Der Angst, dass damit die Mädchenarbeit diskreditiert werde, dürfe nach Pohlkamp kein Gewicht geschenkt werden (vgl. Pohlkamp 2010, 52f.). Schließlich habe sich vor allem die Mädchenarbeit schon oft genug als »Innovationsavantgarde« hervorgetan, indem sie »brisanten Themen« (ebd., 53) Raum gegeben und für die Jugendarbeit fruchtbar gemacht hat, noch bevor an33
dere Teile der Pädagogik diese – wenn überhaupt – in ihren Kanon übernommen hatten (vgl. ebd., 52f.). In diesem Sinne soll sich im kommenden Kapitel damit beschäftigt werden, ob bzw. wie Gedanken aus der Queer Theory in die Mädchen- und Jungenarbeit einfließen können.
IV. Queere Pädagogik? Nachdem nun die Grundlagen der Mädchen- und Jungenarbeit einer radikalen Kritik unterzogen wurden, soll in diesem Kapitel die Frage der Konsequenzen dieser Kritik und der Umsetzbarkeit von Queer Theory in eine pädagogische Praxis diskutiert werden. Vorschläge, wie alternativ gearbeitet werden könnte, möchte ich unter dem Begriff einer »queeren Pädagogik« fassen. In diesem Kapitel soll nun zum einen beschrieben werden, wie eine grobe Rahmung einer solchen Pädagogik aussehen könnte. Zum anderen werde ich auf das Dilemma, dem eine queere Pädagogik zwangsläufig gegenüber steht, eingehen. Schließlich sollen Überlegungen zu einer möglichen praktischen bzw. methodischen Umsetzung angestellt werden. Wie am Titel der Arbeit und dieses Kapitels ersichtlich, schlage ich als distinktive Bezeichnung »queere Pädagogik« vor, um die neueren Konzepte von der heteronormativen Mädchen- und Jungenarbeit abzugrenzen. In der Literatur finden sich auch Bezeichnungen, wie dekonstruktive61 (vgl. Fritzsche et al. 2001a; Tinkhauser 2009 und 2011), geschlechterreflektierende62 (vgl. Voigt-Kehlenbeck 2001) Pädagogik oder »Gender-Pädagogik« 63 (Plößer 2005). Die Bezeichnung »queere Pädagogik« habe ich gewählt, um einen bestimmten Anspruch zu verdeutlichen: Geschlechter nur zu reflektieren – wie es der Begriff »geschlechterreflektierende Pädagogik« in sich birgt – erscheint mir keine Garantie für eine kritische Infragestellung der Zweigeschlechtlichkeit. Zudem wird (sprachlich) die Kategorie der Sexualität nicht mit einbezogen, ohne deren Mitberücksichtigung kein Ausbruch aus der heterosexuellen Matrix möglich ist. Die gleiche Kritik trifft auch auf Plößers Begriffsvorschlag der »Gender-Pädagogik« zu. Der Begriff der »dekonstruktiven Pädagogik« könnte wie61 Plößer dagegen nutzt in Variationen unter anderem den Ausdruck »dekonstruktiv motivierte (feministische) Päd agogik«(vgl. Plößer 2005, 210) und macht damit die Verbindung von Dekonstruktion und Feminismus in ihrem Ansatz deutlich. Sie will Spannung zwischen Dekonstruktion, Feminismus und Pädagogik aufrechterhalten und sieht mit dem Versuch, eine neue dekonstruktive Pädagogik zu entwickeln, die Gefahr, dass sich das dekonstruktive Ele ment – dass sich in einer Unabgeschlossenheit ausdrückt – auflöst (vgl. ebd., 166f.). 62 Voigt-Kehlenbeck verwendet – in Abgrenzung zur geschlechterdifferenzierenden Pädagogik – in ihrem Beitrag den Begriff einer »geschlechterreflektierenden Pädagogik« (Voigt-Kehlenbeck 2001, 237 – Hervorh. i. Orig.). Auch Mart Busche und Laura Maikowski nutzen diesen Begriff, fassen jedoch unter ihm alles, was an geschlechterbezogener Päd agogik neben Mädchen- und Jungenarbeit existiert (vgl. Busche/Maikowski 2010, 162) – einen heteronormativitätskritischen Anspruch erheben sie dabei nicht. 63 Mit dem Begriff »Gender-Pädagogik« will Plößer die »soziale Verfasstheit der Geschlechterdifferenz« (Plößer 2005, 186) hervorheben und die Zentrierung auf lediglich zwei Geschlechter – Jungen und Mädchen – aufheben (vgl. ebd.).
34
derum so gelesen werden, dass realexistierende Benachteiligungen zugunsten einer kategorischen Ablehnung jedweder Arbeit mit Identitäten vernachlässigt werden.64 Demgegenüber ist der Begriff der »queeren Pädagogik« aus meiner Sicht vorzugswürdig, da er durch den Verweis auf die Queer Theory die Reflexion der Machtverhältnisse besser auf den Punkt bringt.65 a. Grundzüge einer möglichen queeren Pädagogik Eine einheitliche »queere Pädagogik« gibt es ebenso wenig wie eine einheitliche Queer Theory. Daher soll an dieser Stelle auf verschiedene Konzepte unterschiedlicher Autor_innen zurückgegriffen werden, um mögliche »Eckpfeiler« einer queeren Pädagogik auszumachen. Bei diesen Ansätzen – wie der Pädagogik vielfältiger Lebensweisen (Hartmann), der Nicht-Identitären Jungenarbeit (Stuve) oder dem Konzept der TransRäume in einer nicht-heteronormativen Mädchen_arbeit bzw. Jungen_arbeit (Pohlkamp) – handelt es sich jeweils nicht um (ab)geschlossene Konzepte, sondern eher bloße erste Anregungen. Die Beiträge in diesem Bereich zeichnen sich – wie an den alternativen Begriffen zur »queeren Pädagogik« sowie den unterschiedlichen Bezeichnungen der gerade genannten Konzepte bereits ersichtlich wurde – durch unterschiedliche Semantiken aus. Und obwohl sie zum Teil weiterhin im Feld der eben noch kritisierten Mädchen- und Jungenarbeit angesiedelt sind, erachte ich die Stoßrichtung der Ansätze für gleichlaufend und (zumindest Teile dieser) unter der Bezeichnung »queere Pädagogik« subsumierbar. Einen wichtigen Beitrag zu einer möglichen queeren Pädagogik hat Jutta Hartmann mit ihrer »Pädagogik vielfältiger Lebensweisen«66 entworfen. Ihre Perspektive speist sich aus der »in Anlehnung an die Kritische Theorie der Frankfurter Schule entwickelten kritischen Pädagogik und […] deren feministischer Kritik und Weiterentwicklung« (Hartmann 2001, 65). Zugleich einer poststrukturalistischen Perspektive folgend, kritisiert sie jedoch die Betonung essentialistischer Vorstellungen von (sexuellen) Identitäten für Emanzipationsbestrebungen der kritischen Pädagogik (vgl. ebd., 71f.). Zudem erweitert Hartmann die »klassische« feministische Kritik um die Erkenntnisse der Queer Theory (vgl. ebd., 68f.) und kritisiert damit verschiedene, von der (differenz-)feministischen Debatte inspirierte Studien (vgl. ebd., 67f.) sowie Konzepte »lesbisch-feministischer Mädchenarbeit« (ebd., 64 Hartmann allerdings versteht dekonstruktive Ansätze so, dass »die bisherigen Begriffe nicht aufgegeben [werden], ihnen jedoch ihre Selbstverständlichkeit genommen« (Hartmann 2004, 19) wird. In ihren Augen gehen also »Differenzen […] unter einer dekonstruktiven Perspektive nicht verloren« (ebd., 31). 65 Denkbar wäre auch, von »queer-feministischer Pädagogik« zu sprechen, wofür der explizite Bezug zum Feminismus spräche. Dies würde allerdings implizieren, »queer an sich« sei auch ohne Feminismus denkbar, was ob seiner Ver bindung zu und Entstehung aus, analytisch nicht zutreffend wäre. 66 Die »Pädagogik vielfältiger Lebensweisen« von Hartmann darf nicht mit Prengels »Pädagogik der Vielfalt« ver wechselt werden. Siehe dazu auch Fußnote 58.
35
71). Mit ihrer Pädagogik der vielfältigen Lebensweisen will Hartmann eine Brücke zwischen Poststrukturalismus und kritischer Pädagogik schlagen und somit Machtwirkungen sowohl auf der Mikro- wie auch der Makroebene67 berücksichtigen können (vgl. ebd., 78). Die Pädagogik der vielfältigen Lebensweisen biete so zum einen »eine öffnende und enthierarchisierende Bewegung, die der Perspektive sozialer und gesellschaftlicher Veränderung folgt« (ebd., 81). Zum anderen – hier wird die Prägung ihres Konzeptes durch Butler68 deutlich – ziele »sie auf eine öffnende Auseinandersetzung, die sich bejahend gegenüber dem Unentscheidbaren einem EntwederOder, einem Positivieren und Verdinglichen von Identitäten widersetzt und sich dem systematischen Hinterfragen eigener normativer Setzungen gegenüber offen hält« (ebd.). Um deutlich zu machen, dass scheinbar feste Identitätsgrenzen beweglich sind, wird am Ausformungsprozess eben jener Grenzen angesetzt: »Butlers wie Foucaults Überlegungen folgend, dass im Auseinanderfalten von Konstruktionsmechanismen das Potential liegt, deren Wirkkraft zu stören, regen entsprechende Analysen an, Konstruktionsmechanismen selbst zum Gegenstand pädagogischer Angebote zu machen, Grenzen zu analysieren und zu reflektieren und so den Fokus pädagogischer Interventionen auf Fragen zur Gestaltung und Ausarbeitung von Existenz- und Lebensweisen zu verlagern. Die Auseinandersetzung mit dem konstruierten Charakter von Existenz- und Lebensweisen mag einem Affirmieren vorherrschender Identitäten und Lebensformen begegnen und einen ersten Schritt in die Richtung darstellen, deren Grenzen als beweglich anzuerkennen.« (Hartmann 2012, 167)
Zentral – für die Lernenden wie auch die Pädagog_innen – soll dabei sein, einerseits die oktroyierten Normen als auch die Konstruktions- sowie Ausschlussmechanismen als solche zu erkennen: »Zu einer zentralen Bildungsaufgabe avanciert es, (den Lernenden zu ermöglichen,) sich für Identifizierungsprozesse zu interessieren und zu erkennen, inwiefern die spezifische Existenz des Subjekts an den Verlust anderer möglicher Existenzweisen geknüpft ist.« (ebd., 171)
Schließlich fasst Hartmann ihr Modell folgendermaßen zusammen: »In meinem Entwurf einer ›Pädagogik vielfältiger Lebensweisen‹ rege ich eine pädagogische Haltung an, die daran orientiert ist, vorherrschende Identitätsannahmen und Normalitätsvorstellungen produktiv zu irritieren, die Dualitäten von Geschlecht und Sexualität zu verflüssigen sowie deren Konstruktionsmechanismen und normative Rahmung zum Gegenstand pädagogischer Auseinandersetzung zu machen. Eine solche Pädagogik intendiert, geschlechtliche und sexuelle Grenzen als beweglich anzuerkennen, die Kontingenz zwischen sex, gender und desire als möglichen Riss wahrnehmbar zu machen und optativ eine Vielzahl von Lebensweisen zu entfalten.« (ebd., 169 – Hervorh. i. Orig.)
Hartmann übersetzt also die theoretischen Grundlagen der Queer Theory in eine »pädagogische Haltung« – sie kann aus meiner Sicht deswegen sehr gut als Grundgerüst einer queeren Pädagogik herangezogen werden.
67 Die Vorteile der jeweiligen Perspektiven, die Hartmann zu verbinden versucht, sieht sie darin, »dass kritische Zugänge Macht vorwiegend im Makrobereich fokussieren und eine materialistische und ökonomische Gewichtung aufweisen und sich poststrukturalistische Zugänge mit einer kulturell-sprachlichen Gewichtung insbesondere auf Machtwirkungen im Mikrobereich konzentrieren« (Hartmann 2001, 78 – Hervorh. J.S.). 68 Hartmann bezieht sich bei ihrem Subjektverständnis zudem stark auf Foucault, was sie mit dem Vorwurf begründet, Butler vernachlässige »die kritische Aktivität des Subjekts« (ebd., 77).
36
Mit dem Versuch, weg von »starren Identitäten« hin zu »prozessualen Identitäten« zu gelangen (vgl. Stuve 2001, 288), schließt Stuve an Hartmann an. In der derzeitigen Jungenarbeit sieht Stuve die Tendenz zu einem rollback, dem er mit seiner nicht-identitären Jungenarbeit eine Alternative entgegensetzten will (vgl. ebd., 288f.). Stuve stellt den Ansatz einer »nicht-identitären« (ebd., 282) bzw. »identitätskritischen Jungenarbeit« (ebd., 288) vor und proklamiert die Absicht mit dem Satz: »Das Ziel ist kein Junge!« (ebd.). Stuve schlägt statt »der Suche nach einem anderen Mannsein […] seine[…] Dekonstruktion« (ebd.) vor. Durch die Ablehnung eines »sex-gender-Determinismus«, also der unweigerlichen Erziehung von als männlich gelesenen Kindern hin zum Junge- respektive Mannsein, erteilt Stuve einer »Suche nach einem mit Authentizität gefüllten Kern« des Mannes eine Absage (vgl. ebd.). Stuve konkretisiert sein Ziel wie folgt: »[E]ine nicht-identitäre Jungenarbeit [ist] zunächst dadurch gekennzeichnet, dass sie sich weigert, Wahrnehmungen und Erfahrungen anhand der Differenzierung von männlichen und weiblichen Körpern zu organisieren« (ebd., 289).
Diese Absicht markiert den Ansatz von Stuve als für eine »queere Pädagogik« gewinnbringend. Denn mit dieser Weigerung ist der Grundstein gelegt, um aus der »heteronormativen Matrix« auszubrechen: »Eine Chance, die aus der Reproduktion der Zweigeschlechtlichkeit weist, ergibt sich erst aus dem Versuch, auf das dichotome Ordnungsschema zu verzichten.« (ebd., 284)
Stuve fragt darüber hinaus, wie »Irritationen und Verschiebungen« der geschlechtlichen Identität möglich sind und kommt zu dem Schluss, dass der »Zwang zur Wiederholung«, der für eine (Geschlechts-)Identität konstitutiv ist, einen guten Anschlusspunkt bieten könnte (vgl. ebd., 288). Dabei will Stuve – wie schon Hartmann – die Konstruktionsmechanismen als solche erkennbar machen: »Die geschlechtlichen Routinen werden dann erlebbar, wenn sie als gemachte bewusst werden, sie als Ergebnisse von sozialen Handlungen und Symbolisierungen erscheinen. Das heißt, die Routinen auf die Spitze treiben, die geschlechtlichen Zuschreibungen jedoch enteignen und das Andere erlebbar machen.« (ebd.)
Mit anderen Worten: Es geht darum, »zu erkennen, dass wir sind, was wir tun« (ebd.), was letztlich eine »Infragestellung, Verflüssigung und Vervielfältigung von Männlichkeiten« (ebd., 285) bzw. Identitäten allgemein ermöglichen würde. Pohlkamp, ehemals in der HVHS Frille tätig, setzt sich für die Einrichtung von »TransRäumen« ein. Sie will mit ihrem Konzept eine Art »TransGender-Mainstreaming«69 in der bestehenden Jun69 Mit der Formulierung des »TransGender-Mainstreaming« spiele ich auf das Verfahren des Gender-Mainstreaming an. Mit der Top-Down-Strategie Gender-Mainstreaming – ein in Aspekten durchaus kritikwürdiges Konzept (vgl. Schenk 2004) – wird versucht die Gleichstellung von Männern und Frauen zu verbessern. Dabei soll auf allen Entscheidungs- und Handlungsebenen überlegt werden, ob und wie sich das Geplante auf die »beiden Geschlechter« bzw. deren Verhältnis zueinander auswirken könnte. Geschlechterverhältnisse und Geschlecht – so das Ziel – sollen also immer und auf allen Ebenen mitgedacht werden (vgl. Tanzberger 2006, 128ff.).
37
gen- und Mädchenarbeit inkludieren, in dem alle Sprachakte und Handlungen, darauf überprüft werden, ob sie Transgender mitberücksichtigen. Statt Fragen in einer Mädchengruppe wie »Was stört euch an Jungen?«, die wie auch ihre Beantwortung »stereotype Jungenbilder« (ebd., 43) bzw. Zweigeschlechtlichkeit gleichermaßen als Norm evozieren, schlägt Pohlkamp Folgendes vor: »In der Mädchenarbeit [muss man] […] von Mädchen bzw. Frauen, Männern bzw. Jungen, Transgender und anderen Geschlechtern […] sprechen. Immer. Ohne Ausnahme.« (ebd., 56)
Transgender-Personen würden so »aus der Nische des ›Nicht-Angerufenen‹ als eine alltägliche Geschlechterform anerkannt« (ebd., 44) bzw. zur »›Normalität‹ qua Anrufung« (ebd., 54) werden. Zudem begreift Pohlkamp in ihrem Ansatz Vergeschlechtlichung als machtvollen und unabgeschlossenen Prozess und greift die Kritik an der heterosexuellen Matrix auf (vgl. ebd., 53f.), was sie an anderer Stelle mit Regina Rauw zu einer heteronormativitätskritischen Jungen_- und Mädchen_arbeit70 ausarbeitet (vgl. Pohlkamp/Rauw 2009; Pohlkamp/Rauw 2010). Neben diesen Aspekten zeichnet sich Pohlkamps Konzept dadurch aus, dass es in Frage stellt, ob die Grenzen von Mädchengruppen sich weiterhin starr auf jene Menschen beziehen sollten, die anhand von »primären und (angenommenen) sekundären Geschlechtsmerkmalen« (Pohlkamp 2010, 54) dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden. Die Autorin plädiert dafür, »die Auseinandersetzungen um weibliche Körper(-inszenierungen) um Auseinandersetzungen mit TransKörper(-inszenierungen) zu erweitern und sie im Komplex [der] Kritik an Schönheitsnormen und Normierungen zum Thema zu machen« (ebd.). So könnte aus einer Mädchenarbeit, »Mädchen_arbeit« (ebd., 55) werden. Eine dritte Gruppe neben den Mädchen- und Jungengruppen auszumachen, hält Pohlkamp indes für verkehrt: »Das bedeutet notwendigerweise (noch) nicht die Einführung einer neuen Geschlechter-Gruppe (Mädchen-, Jungen- und Transgendergruppen), denn dafür sind Trans-Geschlechter (heute noch zu) unsichtbar und darüber hinaus rechtlich, gesellschaftlich und performativ kaum anerkannt« (ebd.).
Pohlkamp fordert stattdessen, »dass als Konsequenz aus bisherigen queeren und dekonstruktivistischen Diskussionen TransRäume in die Mädchenarbeit eingeführt werden« (ebd., 56). In den TransRäumen sollen »Bedeutungen und Begegnungen von Geschlechtern jenseits von eindeutigen Genderrepräsentationen und sexuellem Begehren sowie deren Bewertungen möglich werden« (ebd., 37). Pohlkamp ist sich der Grenzen ihres Konzeptes bewusst und hofft zugleich auf dessen Wirkung: 70 Damit nimmt Pohlkamp (und Rauw) Bezug auf die neueren Entwicklungen der Heimvolkshochschule Frille, die seit 2001 den »Anspruch [verfolgt], die Ideen einer dekonstruktiven Pädagogik mit feministischen Anliegen zu kombi nieren« (Busche et al. 2010b, 10) und im Zuge dessen mit der Ergänzung des Begriffs der Mädchenarbeit mit einem Unterstrich deutlich gemacht hat, dass sie »Gender als interdependente und unabgeschlossene Kategorie verstehen« (ebd., 9). Gleichzeitig zeigen die Autorinnen damit, dass sie sich nach wie vor an dem Grundkonzept der Mädchenund Jungenarbeit orientieren, das heißt an der Arbeit mit den bereits problematisierten »geschlechtshomogenen« Gruppen anschließen.
38
»Trans-Orte in der Mädchenarbeit schaffen keinen normativ freien Raum, schaffen aber das Mehr an Möglichkeitsräumen, die mit geschlechtlicher Lust und Reflexion zu Normalitätskonstruktionen belegt werden können.« (ebd., 56f.)
Allgemeiner Konsens bei den unterschiedlichen Modellen scheint zunächst der Fokus auf die Verflüssigung und ein Hinterfragen von Identitäten zu sein. Gesa Heinrichs und Katharina Pewny heben dies nochmals hervor: »Queere Bildung bedeutet in jedem Fall die Dekonstruktion scheinbar stabiler Geschlechtsidentitäten und Begehrensweisen.« (Heinrichs/Pewny 2006, 234) 71
Einige Autor_innen betonen das Aufbrechen der Binarität allgemein – der Reproduktion eines »›Wir‹ und die ›Anderen‹« bzw. eines »Innen und Außen«, womit immer Hierarchien und Ausschlüsse einhergehen, muss Einhalt geboten werden (vgl. Howald 2001, 300ff.; Plößer 2009, 61f.). Zudem muss, wie unter anderem Pohlkamp zeigt, der Raum jenseits von hegemonialen Identitätskonzepten zugänglich gemacht werden (vgl. Pohlkamp 2010, 37). Schließlich wird die Notwendigkeit einer ständigen Reflexion und Weiterentwicklung der Theorie und Praxis einer queeren Pädagogik betont. Queer könne nach Plößer »vor allem als Aufforderung an die Pädagoginnen verstanden werden, die eigenen Normen aufzuspüren und diese kritisch zu reflektieren« (Plößer 2009, 61). Das Postulat der »Offenheit, Veränderbarkeit und Konflikthaftigkeit« gilt nicht nur für Identitäten, sondern für queere Konzepte selbst – sowohl auf theoretischer wie auch praktischer Ebene: »›Queer‹ selbst ist […] nicht als statisches Konzept zu verstehen, sondern – und da schließt ›queer‹ an feministische und kritische Traditionen an – als sich beständig verändernder, einer permanenten Selbstreflexion unterworfener Prozess.« (Heinrichs/Pewny 2006, 232)
Demnach ist ebenso eine »[q]ueere (Bildungs-)Theorie […] weder fertig noch geschlossen oder etabliert« (ebd., 233). Mit einer reflexiven Rückbindung der Theorie an die Praxis und der Praxis an die Theorie, könnte verhindert werden, dass die Umsetzung von eigentlich schon länger gewonnenen Erkenntnissen nicht abermals mehrere Jahrzehnte benötigt. Neben dem Blick auf eine explizit pädagogische Praxis wäre es ebenso wichtig, an die (auch nicht-deutschsprachigen) queer-feministisch aktiven Szenen bzw. Queer Politics anzuknüpfen, wo sich schon länger mit der Frage nach der Öffnung von Frauenräumen für Transgender beschäftigt wird (vgl. bspw. GLADT e.V. 201172). Auch der Blick auf die Identitätsbildung muss mit einer queeren Perspektive verändert werden. Statt 71 Eine Auseinandersetzung um die Unterschiede zwischen Begriffen wie Bildung, Pädagogik, Erziehungswissenschaf ten, Bildungstheorie etc. kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. 72 GLADT e.V. ist ein Verein mit Sitz in Berlin, in dem sich vor allem Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle und Transgender (LSBTT) mit Verbindung zur Türkei organisieren.
39
wie in der Mädchenarbeit (und entsprechend der Jungenarbeit), Mädchen in essentialistischer Weise auf die ihnen qua Mädchen-Sein innewohnende Geschlechtsidentität zu verweisen, könne vielmehr die Erfahrung der Unabgeschlossenheit und Uneindeutigkeit zu einem kritischen Bewusstsein über sich und die eine_n umgebenden Zwänge verhelfen: »Anders als die in den Mädchenarbeitskonzepten formulierte Aufgabe, Mädchen durch die Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität bzw. durch weibliche Identifikationsfiguren zur kritischen Einsicht in die patriarchalen Normen zu befähigen, bietet der Butlersche Ansatz eine Verschiebung dieses Anspruchs. Nicht, dadurch, dass das Subjekt weiß, wer es ist, nicht dadurch, dass es eine kohärente Erzählung von sich hat oder von der Pädagogin geliefert bekommt, wird es kritisch. Vielmehr wird es die Bedingungen, die seine Subjektposition regulieren, gerade dann in Frage stellen, wenn die Erzählung durcheinander gerät, wenn sich der rote Faden verliert, wenn das Subjekt sich selbst als undurchsichtig, als brüchig und abhängig von Normen begreift.« (Plößer 2005, 208f.)
Doch wie kann mit einer solchen von hegemonialen Geschlechtsbildern losgelösten Identität den Zumutungen entsprochen werden, die aufgrund der Wirkmächtigkeit der Kategorie Geschlecht trotzdem noch auf die (in der derzeitigen Gesellschaft) zwangsweise vergeschlechtlichten Subjekte wirkt? Eine in diesem Theoriefeld unausweichliche Auseinandersetzung mit diesem, durch emanzipatorischen und gleichzeitigem dekonstruktiven Anspruch einer queeren Pädagogik aufkommenden Paradox einer Anerkennung bei zeitgleichem Versuch der Veruneindeutigung soll im kommenden Kapitel geführt werden. b. Das Dilemma einer queeren Pädagogik zwischen Wirkmächtigkeit und Dekonstruktion Es gibt Theoretiker_innen aus dem erziehungswissenschaftlichen Kontext und mit poststrukturalistischem Hintergrund, die von einer »postfeministischen Pädagogik« sprechen (vgl. Heinrichs 2002) – ein Begriff und ein Diskurs von dem ich mich abgrenzen möchte: Eine Gegenüberstellung von Feminismus und poststrukturalistischen Ansätzen wie der Queer Theory – wie sie durch den Begriff »postfeministisch« evoziert wird – würde implizieren, dass viele dem Feminismus entstammenden Erkenntnisse, Errungenschaften und (Verfahrens-)Modelle – wie eben die feministische Mädchenund Jungenarbeit – nun überflüssig seien. Die Vorstellung einer binären Geschlechterordnung ist gesellschaftlich allerdings (noch) viel zu wirkmächtig, als dass man es sich erlauben könnte, Maßnahmen gegen realexistierende soziale Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen mit Verweis auf das (durchaus hehre) Ziel aufzugeben, die Geschlechterdifferenz aufweichen oder auflösen zu wollen.73 In diesem Sinne stelle ich mich auch klar gegen einen pauschalen Verzicht auf (mädchen-)parteiliche Maßnahmen in der Pädagogik, wie ihn zum Beispiel die Autorin Gesa Heinrichs propagiert (vgl. ebd., 163).74 Will man Zumutungen, die aus der heterosexuellen Matrix entstammen, entgegen73 In dieser Logik – Stichwort »post-gender« – wehren sich Teile der sich zeitweise großer Beliebtheit erfreuenden Pi ratenpartei gegen formal-demokratische Verfahren zur Frauenförderung (vgl. Kegelklub 2012, 30). 74 Dies gilt – wie im Laufe der Arbeit deutlich werden wird – auch für die Förderung von anderen marginalisierte Posi tionen und Identitäten.
40
treten, dürfen diese jedoch auch nicht ignoriert werden. Es muss also einerseits durchaus anerkannt werden, dass Identitäten in konstruktivistischer Weise hergestellt werden. Es darf jedoch andererseits nicht außer Acht gelassen werden, dass Geschlechtszuschreibungen wirkmächtig bleiben. Hierin zeichnet sich ein Dilemma ab, das, wie gezeigt wird, zu den Grundzügen einer queeren Pädagogik gehört. Die unauflösliche Widersprüchlichkeit äußert sich darin, dass eine queere Pädagogik die »einerseits die vielfach konstruierte Differenz der Geschlechter ernst zu nehmen [hat], ohne sie andererseits festzuschreiben und zu verstärken« (Dausien/Thon 2009, 346). So bezeichnet Hartmann den Konflikt, der sich laut Dausien und Thon nicht nur in der Theorie und Forschung, sondern auch in der pädagogischen Praxis findet (vgl. ebd.), als Paradox: »[Die] erziehungswissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung [muss sich] mit dem Paradox auseinandersetzen, dass Mädchen- und Jungenarbeit ebenso wie lesbisch-schwule Bildungsarbeit an Geschlechterdichotomie und heterosexuellen Normen ansetzt und damit zunächst aufruft, was sie irritieren will.« (Hartmann 2009, 56)
Mart Busche und Ellen Wesemüller formulieren es in ihrem »Manifest für Mädchen_arbeit« etwas salopper: »Einerseits wollen wir Mädchen als Zuordnung abschaffen, andererseits sind sie so verdammt da.« (Busche/Wesemüller 2010, 318)
Rauw und Drogand-Strud sprechen vom »Gender-Paradox« und beschreiben damit, »dass Gender zum einen als Analysekategorie benannt werden muss […], um die gesellschaftliche Ungleichheit […] aufzudecken« (Drogand-Strud/Rauw 2010, 266) – womit eine Anrufung von Männern und Frauen und damit eine Reproduktion der Zweigeschlechtlichkeit einhergehen würde. Und zum anderen gelte es gleichzeitig, »›Gender‹ im Sinne der existierenden Geschlechterordnung zu demontieren und damit zum Abbau von Herrschaft beizutragen« (ebd.). Aus einem Dilemma gibt es keinen letztendlich zufriedenstellenden Ausweg. Jedoch wäre es angesichts der derzeitigen Verfasstheit von heteronormativer Mädchen- und Jungenarbeit ein großer Schritt – wenn man schon nicht auf parteiliche, ausgleichende Maßnahmen verzichten kann und sich in der pädagogischen Praxis somit heteronormatives Denken weiterhin reproduziert – die daraus resultierenden Zumutungen wenigstens zu reduzieren. Plößer hat sich genau das vorgenommen: Sie will das Parteilichkeitsprinzip derart »revitalisieren« (Plößer 2005, 179), dass den in ihm innewohnenden Paradoxien »Rechnung getragen wird« (ebd.) – mit dem Ziel »die ›Gewaltförmigkeiten‹ des Postulats zu minimieren« (ebd.). Dabei nimmt sie vor allem Theorien von Judith Butler zu Hilfe, um »von einem identitär begründeten, entschiedenen Handeln hin zu einem sich die Grenzen von Anerkennung eingestehenden Handeln« (ebd., 180) zu gelangen. Plößer plädiert mit Blick auf dekonstruktivistische Theorien für eine bewusste Anerken41
nung der Grenzen der Parteilichkeit (vgl. ebd., 187.), für ein Eingeständnis (vgl. ebd., 194) und Reflexion (vgl. ebd., 197) der Abhängigkeiten der Pädagogik von Normen, für die »Einsicht in die Grundlosigkeit der solidarischen Haltung […] wie nicht zuletzt auch […] der Kultivierung von Neugier« (ebd., 210 – Hervorh. i. Orig.). Die Parteilichkeit kann so keine festen Adressat_innen mehr haben – warum man gegenüber einer bestimmten Person parteilich ist, muss immer wieder neu verantwortet werden (vgl. ebd., 183). Damit wird die Unabgeschlossenheit und Offenheit der Identitätsbildung berücksichtigt. Zugleich kann eine »Frau zu sein« durchaus (auch) Grund für Parteinahme sein, nur müssen die dahinterstehenden Normen und Kategorien jedes Mal neu hinterfragt werden (vgl. ebd.). Damit wiederum bleiben die Ungleichheiten auf der nicht-symbolischen Ebene im Blickfeld. Eine queere Pädagogik muss – so lässt sich das Gesagte der letzten zwei Unterkapitel zusammenfassen – im Wesentlichen Folgendes leisten: In dem Bewusstsein, Ausschlüsse nicht komplett vermeiden zu können, muss eine queere Pädagogik zunächst versuchen, sie zu minimieren. Damit hängt das Erkennen und Aushalten von eigenen Grenzen, Inkohärenzen und Widersprüchlichkeiten zusammen. Es gilt die Beweglichkeit und »Konstruiertheit« von scheinbar festen Identitäten aufzuzeigen und für die Kinder und Jugendlichen wahrnehmbar zu machen als auch (in zunächst geschützten Räumen) den Freiheitsgewinn erfahrbar zu machen. Dabei muss auf ein dichotomes Ordnungsschema verzichtet werden. Zudem darf eine queere Pädagogik Ungleichheiten nicht nur auf symbolischer, sondern auch auf struktureller, politischer, rechtlicher oder materieller Ebene im Blick behalten. Schließlich muss sie immer wieder ihre eigenen Annahmen und Praxen hinterfragen und verändern, also einen reflexiven Anspruch verfolgen. Zum Postulat der Unabgeschlossenheit und Veränderlichkeit gehört auch, dass die eben gemachte Aufzählung ergänzt werden kann und muss. c. Praktische und methodische Ansätze queerer Pädagogik Nachdem nun die (eher theoretischen) Grundzüge einer queeren Pädagogik dargestellt wurden, soll nun eine Idee davon präsentiert werden, wie eine queere Pädagogik in der Praxis aussehen könnte. Auch hierbei beziehe ich mich auf Material aus der Literatur. Die im Folgenden vorgestellten Methoden sind keine unveränderlichen und perfekten Anleitungen – das sollte sich in der Pädagogik trotz Ratgeberboom von selbst verstehen – sondern vielmehr zur Anregung gedacht, wie man die in dieser Arbeit bislang vor allem theoretisch diskutierten Ansätze praktisch umsetzen kann bzw. was es dabei zu beachten gilt. 42
Pohlkamp und Rauw wollen sowohl bei den Adressat_innen als auch bei den Pädagog_innen Lust, Freude und Spaß am Handeln und Denken abseits von normativen Lebens- und Denkweisen initiieren und somit zur Reduktion von Gewalt und Hierarchie beitragen (vgl. Pohlkamp/Rauw 2010, 23; ebd., 27). Für eine heteronormativitätskritische pädagogische Praxis schlagen die beiden drei Grundvoraussetzungen vor, die auf ein Konzept einer queeren Pädagogik übertragbar wären. Erstens gilt es vermeintliche Selbstverständlichkeiten als eben nicht-selbstverständlich zu entlarven. Es müssen zum Beispiel in der Diskussion um (zukünftige) Kindererziehung, der Frage nach Sex und Lust bzw. Verhütung und Safer Sex »heteronormative Selbstverständlichkeiten transparent gemacht und Alternativen eröffnet werden« (ebd., 25). Werden also bei der Familienplanung die Kinder und Jugendlichen von vornherein als zukünftiger Teil eines monogam-lebenden, heterosexuellen Elternpaares mit Kind bzw. einem Kinderwunsch überhaupt behandelt? Oder werden auch Bilder von Mehr-Generationen-Patchwork-Familien, homosexuelle, asexuelle oder in offenen oder polyamoren75 Beziehungen lebenden Elternpaare oder auch kinderlos-glückliche Beziehungen als »selbstverständlich« (und nicht in einer gesonderten Einheit unter »andere Beziehungskonzepte«) gezeigt? Geht es beim Thema Safer Sex nur um Schwangerschaftsverhütung oder wird gleichberechtigt auch über sexuell übertragbare Krankheiten zwischen nicht heterosexuell und monogam lebenden Menschen sowie bei Sexualpraktiken abseits von Koitus gesprochen?76 Da es Aufgabe einer queeren Pädagogik sein soll, »Normalitäten zu hinterfragen und zu erweitern und den Mädchen damit mehr Handlungsspielräume, Reflexionsangebote zu ermöglichen« (ebd., 26), benötigen Pädagog_innen zweitens selbst Wissen über nicht-heteronormative Lebensweisen, die damit verknüpften rechtlichen Fragen und die geschichtliche Wandelbarkeit der Geschlechter- und Sexualitätskonzepte (vgl. ebd.).77 Drittens müssen Pädagog_innen Position bei Diskriminierungen von homo-, bisexuellen oder queeren Beziehungskonzepten beziehen, gegebenenfalls sofort intervenieren und zu einem geeigneten Zeitpunkt den Fall wieder aufgreifen bzw. nach den Beweggründen für diskriminierende und normierende Sprüche, Gesten oder Handlungen fragen, um so zum Nachdenken anzuregen (vgl. ebd., 27f.). Dabei sollte keine Exotisierung bzw. kein Othering betrieben werden, also zum Beispiel »das Andere« lediglich als »anders« anzuerkennen, aber damit zugleich als »nicht-normal« zu kennzeichnen.
75 Polyamorie ist – vereinfachend gesagt – eine Beziehungsform in der Beziehungen zu mehr als einer Person und im Wissen aller Beteiligten geführt werden (vgl. Barta 2012, 4). 76 Tuider setzt sich mit der Frage nach einer nicht-heteronormativen Sexualpädagogik in ihrem Text »Identitätskonstruktionen durchkreuzen – Queer – Hybridität – Differenz in der Sexualpädagogik« auseinander (vgl. Tuider 2004). 77 Ich würde zudem das Wissen um biologische und medizinische Erkenntnisse – abseits der heteronormativen Erzählungen – als wichtig erachten.
43
Einen methodischen Vorschlag unterbreitet Stuve: Für ihn fungiert der Körper in der Frage nach der Geschlechtsidentität »wie ein natürlicher Referent« (Stuve 2001, 289), in dem sich »Erwartungen und Zuschreibungen […] materialisieren« (ebd.). Davon ausgehend wählt Stuve den Körper als einen Ausgangspunkt für sein Praxisbeispiel einer queeren Pädagogik. Stuve schlägt eine angeleitete Körperreise in ruhigerer Atmosphäre vor, wobei an die »männlichen« Kinder bzw. Jugendlichen Fragen nach Atmung, des »Sich-Anfühlens« oder visuellen Erinnerungen einzelner Körperteile gestellt werden (vgl. ebd., 291). Seine »Arbeit mit dem Körper« hat zum Ziel, bei als Jungen sozialisierten Kindern und Jugendlichen zunächst eine »Body Awareness« zu ermöglichen. Dabei sei es »den Jungen« möglich sich zu entspannen, ihren Körper zu fühlen und zu erleben. Dies sei etwas vollkommen Neues für »die Jungen«, die bei ständigem Selbststilisierungszwang in permanenter Anspannung leben und ihrem Körper schon früh als ein zu funktionierendes Instrument empfinden (vgl. ebd., 291f.).78 Ausgehend von der Erfahrung, seinen Körper anders wahrnehmen zu können, kann die »Historizität oder die Bedingungen seiner [– des Körpers –] Konstituierung selbst zum Inhalt« (ebd., 290) von weiteren Gedanken und »die Verengungen und Ausschlüsse von Möglichkeiten erlebbar« (ebd., 292) werden. Stuve schränkt die Wirksamkeit seines Praxisbeispiel jedoch ein: Ob nach solchen Erfahrungen in der »Kultur der Zweigeschlechtlichkeit« verbleibend an einem »›anderen Jungen‹ gearbeitet […] oder mit der Idee die Selbstkonstruktion, Ausschließungen und Differenzierungen sowie deren Brüche und Diskontinuitäten […] thematisier[t]« (ebd., 288) werden kann, sei abhängig von der_dem jeweiligen Pädagog_in.79 Stuve nennt in seinem Beitrag der Dokumentation der Tagung »Grenzverwischungen« noch weitere Methoden, wobei ich die der »Biographie-Kurve« (Stuve 2004, 174) hervorheben möchte. In dieser Methode steht die Frage im Raum, wann vergeschlechtlichende Erfahrungen gemacht wurden (vgl. ebd.). Mit konkreten Fragen wie »Wann habe ich mich als Kind/JugendlicheR das erste Mal als männlich oder weiblich angesprochen gefühlt; wann habe ich mich das erste Mal latent entsprechend inszeniert?« (ebd., 174f.) soll erfahrbar gemacht werden, wie das eigene Geschlecht produziert wurde. Ziel dieser Übung ist es also, nicht Fragen nach »gemeinsamen Erfahrungen« (ebd.) als »Mann« oder »Frau« in den Mittelpunkt zu stellen. Stattdessen sollen Fragen zentral sein, die dazu 78 Stuve geht hier offenbar von einer Erfahrungskongruenz innerhalb der Gruppe aus, das mit dem »Junge-Sein« begründet wird. Hier zeigt sich das problematische Paradox: Man geht von etwas aus, um zu dekonstruieren und repro duziert es dabei im gleichen Moment. 79 Auch Christoph Grote und Olaf Jantz beschreiben die »Person des Jungenarbeiters [als] […] das wichtigste Werk zeug« (Grote/Jantz 2003, 93) der Jungenarbeit. Allerdings verbleiben die beiden Autoren bei dem Bild von einem »anderen Jungen«, also einem essentialistischen Geschlechterbild, wenn sie von der_dem Pädagog_in (bei Grote und Jantz heißt es »Pädagoge«) verlangen, die »alltägliche Ausgestaltung von Männlichkeiten erleb- und verhandel bar für Jungen zu machen« (ebd., 93f.).
44
anregen, »Zwischenräume zu erahnen« (ebd., 175) und die »die Reflexion der Jugendlichen über die eigene geschlechtliche Geschichte« (ebd.) befördern. Für eine weitere Methode, die ebenfalls das Ziel hat, festschreibende Identitätskonstruktionen in Frage zu stellen, zieht Howald die Methode der freien Theaterarbeit und des angeleiteten Spiels heran. Dabei hofft sie, mit Varianten des Rollenspiels bzw. dem »Postkartenspiel« 80 würden »Frauenbilder diversifiziert« (Howald 2001, 306). Man kann dabei den Eindruck gewinnen, Howald wolle den Mädchen zwar viele unterschiedliche und »irgendwie« abweichende, aber nur weibliche Identifikationsmöglichkeiten anbieten. Mit der Beschränkung von »Ausnahmen« innerhalb dessen, was als weiblich verstanden wird, läuft Howald Gefahr am dichotomen Ordnungsschema festzuhalten. Lediglich eine Fußnote weist bei ihr darauf hin, es könnten »auch männliche Rollen ausprobiert werden« (ebd.). Den Mädchen müssten jedoch zeitgleich zu den »weiblichen« explizit auch »männliche« und uneindeutige Rollen zur Auswahl stehen, um die Möglichkeit des Bruchs mit Geschlechtergrenzen praktisch zu veranschaulichen und um dabei die Hierarchien reproduzierende Binarität zu überkommen. Plößer greift die Idee Howalds auf, Rollenspiele als Möglichkeit »andere Identitätsdarstellungen aus[zu]probieren wie auch Konflikte und Sanktionen, die mit den jeweiligen Inszenierungen verbunden sein können, reflektieren zu lassen« (Plößer 2009, 62) und so die Vervielfältigung von Identitäten methodisch anzuregen (vgl. ebd.). Stuve stellt im Jahr 2004 fest, dass ein »großer Bedarf an einer weiteren Methodenentwicklung« (Stuve 2004, 177) bestehe – und hat damit nicht Unrecht. Allerdings wäre es fahrlässig, sich nur auf die Entwicklung neuer Methoden zu versteifen.81 Es zeigt sich schließlich, dass sich die vorgestellten Methoden und Praxen an sich denen in der bisherigen Mädchen- und Jungenarbeit ähnlich sind. Ob heteronormative Ideale weiter bedient werden oder queere Vorstellungen von Identitäten ihren Platz finden können, ist also vor allem eine Frage der Vermittlung. Das deutet darauf hin, dass der Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte vermehrt Beachtung geschenkt werden muss: Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, Wertvorstellungen und 80 Bei dieser Methode werden Postkarten mit unterschiedlichen Typen von – im Beispiel Howalds nur weibliche – Per sonen ausgelegt, von denen die Kinder bzw. Jugendlichen die auswählen sollen, die sie am meisten interessiert/er staunt/auffällt und sollen dies begründen und ggf. die Biographie recherchieren. 81 In der Frage nach weiteren Anregungen wäre sicherlich ein Blick in die bestehenden Einrichtungen, die sich mit nicht-heteronormativer Mädchen- und Jungenarbeit auseinandersetzen, und die queer-politisch aktive Szene – ein Beispiel wäre der Berliner Verein ABqueer e.V. – gewinnbringend.
45
»blinden Flecken« in der Wahrnehmung muss angestoßen werden. Parallel dazu muss das Wissen über die durch Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität hervorgebrachten Zwänge, Normierungen und Ausschließungen ebenso in den Kanon der Ausbildung übernommen werden, wie das Wissen über alternative Lebensweisen. Erst mit dem entsprechendem Wissen und Reflexionsvermögen wird es möglich, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weniger normierend zu gestalten.
Abschließende Bemerkungen Zu Beginn dieser Arbeit stand die Frage im Raum, ob eine Mädchen- und Jungenarbeit mit den Er kenntnissen aus der Queer Theory heute überhaupt noch zeitgemäß ist. Mit Hinblick auf die vorliegende Arbeit kann nun abschließend zusammengefasst werden: Ja, Mädchen- und Jungenarbeit ist vereinbar mit einer queeren Perspektive und muss weiterbetrieben werden. Diese Aussage kann jedoch nur unter einer gewissen »Auflage« getroffen werden: Mädchen- und Jungenarbeit muss sich entscheidend verändern – weg von der Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität hin zu einer Vorstellung von Identitäten und kategorialen Zugehörigkeiten als offen, veränderbar und widersprüchlich. Dabei sind die in dieser Arbeit vorgebrachten Vorschläge zu Theorie und Praxis nur ein Anfang. Queere Pädagogik kann es ohne Rückgriff auf Mädchen- und Jungenarbeit nicht geben. Doch auch eine Mädchen- und Jungenarbeit kann ihren emanzipatorischen Anspruch ohne eine Veränderung ihrer Praxen und Herangehensweisen nicht aufrechterhalten. Eine queere Pädagogik kann hier in einer spezifischen, kritischen und analysierendem Sichtweise dazu führen, dass bestehende Konzepte verändert werden – mit dem Ziel, Exklusionen und Hierarchisierungen von Geschlechtern und Sexualitäten zu vermeiden und Handlungsmöglichkeiten jenseits normierender und gewaltvoller (zwei-)geschlechtlicher Zuschreibungen zu eröffnen. Pädagog_innen müssen in diesem Arbeitsfeld über sich und ihre eigene Rolle, ihre Praxen und Vorstellungen von Geschlecht und Identität und damit zusammenhängende Probleme nachdenken und sich auch auf (queer-)theoretischer Grundlage damit beschäftigen. Daher ist zu fordern, Auseinandersetzungen mit queeren Theorien verstärkt in Ausbildung, Studium und Weiterbildung zu verankern. Gleichzeitig wäre es wünschenswert, wenn sich Autor_innen wissenschaftlich-theoretischer Texte – dabei schließe ich mich mit ein – öfter in der Praxis »umtun würden«, um die Verknüpfung von queerer Theorie und queerer Praxis weiter voranzutreiben. Wenn über die Entwicklung einer queeren Pädagogik in der Praxis nachgedacht wird, muss zudem der gesamt-gesellschaftliche Kontext mitreflektiert werden. Ein wichtiger Faktor ist der Einfluss neo46
liberaler Ideen in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen. So sehen sich Bildung und Pädagogik heute vermehrt mit neoliberalen Anforderungen konfrontiert (vgl. Ortner 2007, 29f.; Busche/Wesemüller 2010, 314). Teilweise wird queeren Konzepten der Vorwurf gemacht, sie seien besonders anfällig für neoliberale Vereinnahmungen. Möchte man die Umsetzung queerer Konzepte in der Pädagogik fördern, sollte man sich mit solchen Vorwürfen auseinandersetzen. Ortner sieht beispielsweise in Anbetracht neoliberaler Tendenzen, die die ökonomische Dimension überschreiten und nunmehr alle Lebensbereiche erfassen, die Gefahr einer »neoliberale[n] Indienstnahme feministischer Bildung« (Ortner 2007, 30). Denn auch der Neoliberalismus fordere zur »Flexibilisierung von Identität« auf. Somit seien die Forderungen nach mehr Flexibilisierung scheinbar82 im Einklang mit dekonstruktiven Subjektkritiken (vgl. ebd., 29).83 Und tatsächlich fassen die in dieser Arbeit behandelten Autor_innen »gesellschaftliche Erwartungen nach Mobilität und Flexibilität« (Hartmann 2004, 18) als »Herausforderungen« (ebd.) auf, anstatt ihnen ob ihrer neoliberalen und ausschließenden84 Züge kritisch zu begegnen. Und an Stelle der Forderung nach gesellschaftlicher Veränderungen und Verantwortung wird an die »Fähigkeit der Individuen« (ebd., 19) appelliert, »abnehmende Kontinuität und Kohärenz nicht nur auszuhalten, sondern wenn möglich auch produktiv zu nutzen, vielleicht gar zu genießen« (ebd.).85 Die Herausgeberinnen des Sammelbandes »Feministische Mädchenarbeit weiterdenken« (2010) positionieren sich demgegenüber deutlich und fordern in der Einleitung, dass kritische Mädchenarbeit »ihren kritischen Kern des politischen Widerstands gegen menschenunwürdige Bedingungen [nicht] aus den Augen […] verlieren« (Busche et al. 2010b, 7) dürfe und fragen weiter: »Wie kann queer-feministische, emanzipatorische Mädchen_arbeit in Zeiten eines neoliberalen Kapitalismus aussehen?« (ebd., 11)
Zusammen mit Ortner muss aus meiner Sicht eine Bildungstheorie und -politik verfolgt werden, die die fehlende Mitberücksichtigung von »ökonomische[n] Subjektzumutungen« (Ortner 2007, 43) in den Blick nimmt und sich einer »Vereinnahmung aller Subjekte als Humanressourcen« (ebd., 30) 82 Beispiele für queer-politische Praxen, die sich gegen eine »Depolitisierung« und neoliberale Tendenzen wenden, zeigt Autorin Anne Marie Smith auf (Smith 2000). 83 Auch Engels sieht die Queer Theory – mit ihrer Forderung nach Offenheit und Verflüssigung von starren Identitäten – in Gefahr neoliberal vereinnahmt zu werden (vgl. Engel 2007, 297f.). 84 Die Anforderungen sind eigentlich nur für diejenigen Menschen erfüllbar, die ohne körperliche und geistige Beein trächtigungen, ohne Familie, mit einem Pass, der ihnen Grenzüberschreitungen erlaubt, etc. leben. Viele Menschen bleiben deshalb von gesellschaftlicher Teilhabe und Wohlstand ausgeschlossen. 85 Hartmann muss trotz alledem zu Gute gehalten werden, dass sie reaktionären Positionen, die zurück zu (vermeint lich) gefestigten Identitäten wollen und Veränderungen und Pluralisierungen als Gefahr für ihre nationale, patriarchale oder »ständische« (im Sinne von Klasse) Identität begreifen, folgendes entgegensetzt: »Ich möchte die mit dem gesellschaftlichen Wandel einhergehenden Dynamisierungen […] explizit auch als herausfordernde Chance und Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und nicht vorrangig, wie zumeist diskutiert, als Verlust und Bedrohung verstehen.« (Hartmann 2004, 19)
47
entgegenstellt.86 Eine Weiterentwicklung einer queeren Pädagogik muss demnach stets in einer kritischen Auseinandersetzung mit neoliberalen Tendenzen erfolgen.
86 Ortner verbindet dazu postmoderne, feministische Bildungstheorie mit kritischer Bildungstheorie bzw. Kritischen Theorie zu einer »kritisch-feministischen Bildungstheorie«, »die in ihrem Subjektverständnis geschlechtliche und ökonomische Zumutungen bedenkt« (Ortner 2007, 30) und neoliberale Vereinnahmungen zurückweisen könne (vgl. ebd.).
48
Literatur- und Quellenverzeichnis Albrecht-Heide, Astrid (2005): Weißsein und Erziehungswissenschaf. In: Eggers, Maureen M./Kilomba, Grada/Piesche, Peggy/Arndt, Susan (Hg.): Mythen, Masken und Subjekte – Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Münster: Unrast, S. 444-459 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2008): Diskriminierung im Alltag Wahrnehmung von Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesellschaf – Abschlussbericht. Heidelberg: Nomos Balzer, Nicole/Ricken, Norbert (2012a) (Hg.): Judith Butler – Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Balzer, Nicole/Ricken, Norbert (2012b): Pädagogische Lektüren – Ein Vorwort. In: dies. (Hg.): Judith Butler – Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9-14 Barta, Elena (2012): Love and Care – Über die Verknüpfung der romantischen Zweierbeziehung mit Reproduktionsarbeit und mögliche Alternativen – Ein Kommentar. In: HochschülerInnenschaft an der Uni Wien/Verein zur Förderung studentischer Medienfreiheit (Hg.): UNIQUE – Aber hier leben, nein Danke! (Wien), Nr. 5/2012 (Mai 2012), o. Jg., S. 4 Behnisch, Michael/Bronner, Kerstin (2007): Mädchen- und Jungenarbeit in den Erziehungshilfen – Einführung in die Praxis einer geschlechterreflektierenden Pädagogik. München/Weinheim: Juventa Bentheim, Alexander/May, Michael/Sturzenhecker, Benedikt/Winter, Reinhard (2004): Gendermainstreaming und Jungenarbeit. München/Weinheim: Juventa Blomberg, Christoph (2003): Geschichte der Jungenarbeit. (Ursprünglich veröffentlicht in Rundbrief der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW 02/2003) – URL: http://www.lagjungenarbeit.de/downloads/grundlagen/geschichte-jungenarbeit.pdf (Zugriff am 19. Dezember 2012) Bock, Gisela/Duden, Barbara (1977): Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit. In: Herausgeberkollektiv Frauen und Wissenschaft: Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen. Berlin: Courage, S. 118-187 Böger, Claudia (1995): Erziehung und weibliche Identität – Zur Thematisierung der Geschlechterdifferenz in der pädagogischen Semantik. Weinheim: Deutscher Studien Verlag Budde, Jürgen (2009): Perspektiven für Jungenforschung an Schulen. In: Budde, Jürgen/Mammes, Ingelore (Hg.): Jungenforschung empirisch – Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 73-89 49
Busche, Mart (2010): It’s a men’s world? Jungen_arbeit aus nichtmännlicher Perspektive. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 201-221 Busche, Mart/Cremers, Michael (2010): Jungenarbeit und Intersektionalität – und was dieses Thema in einem Mädchenarbeitsbuch zu suchen hat. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 223-246 Busche, Mart/Maikowski, Laura (2010): Reflexive Koedukation revisited – Mit Geschlechterheterogenität umgehen. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 161-179 Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (2010a) (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (2010b): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Eine Einleitung. In: (dies.) (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 7-20 Busche, Mart/Wesemüller, Ellen (2010): Mit Widersprüchen für neue Wirklichkeiten – Ein Manifest für Mädchen_arbeit. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 309-324 Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp Butler, Judith (2001): Psyche der Macht – Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Butler, Judith (2012): Gender and Education. In: Balzer, Nicole/Ricken, Norbert (Hg.): Judith Butler – Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 15-28 Castro Varela, Maria do Mar/Mecheril, Paul (2010): Anerkennung als erziehungswissenschafliche Referenz? Herrschafskritische und identitätsskeptische Anmerkungen. In: Schäfer, Alfred/Thompson, Christiane (Hg.): Anerkennung. Paderborn: Ferdinand Schöningh, S. 89118 Dausien, Bettina/Thon, Christine (2009): Gender. In: Andresen, Sabine/Casale, Rita/Gabriel, Tho50
mas/Horlacher, Rebekka/Klee, Sabina Larcher/Oelkers, Jürgen (Hg.): Handwörterbuch Erziehungswissenschaf. Weinheim: Beltz, S. 336-349 de Beauvoir, Simone (1999): Das andere Geschlecht – Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Drogand-Strud, Michael/Rauw, Regina (2010): 20 Jahre, sechs Bausteine, mehr als zwei Geschlechter und mindestens ein Paradox – Veränderung und Kontinuität in der geschlechterbezogenen Wei terbildungsreihe der »Alten Molkerei Frille«. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 263-287 Ehrenspeck, Yvonne (2001): Strukturalismus und Poststrukturalismus in der Erziehungswissenschaf – Thematische, theoretische und methodische Implikationen einer Rezeption. In: Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 21-33 Engel, Antke (2007): Entschiedene Interventionen in der Unentscheidbarkeit – Von queerer Identitätskritik zur VerUneindeutigung als Methode. In: Hark, Sabine (Hg): Dis/Kontinuitäten – Feministische Theorie. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 285-304 Faulstich-Wieland, Hannelore (1995): Geschlecht und Erziehung – Grundlagen des pädagogischen Umgangs mit Mädchen und Jungen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Faulstich-Wieland, Hannelore (1997): Geschlecht und Erziehung. In: Bernhard, Armin/Rothermel, Lutz (Hg.): Handbuch kritische Pädagogik – Eine Einführung in die Erziehungs- und Bil dungswissenschaf. Weinheim: Beltz, S. 232-243 Faulstich-Wieland, Hannelore (2011): Werden tatsächlich Männer gebraucht, um Bildungsungleichheiten (von Jungen) abzubauen? In: Hadjar, Andreas (Hg.): Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 393–415 Flick, Uwe (2007): Qualitative Sozialforschung – eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: RowohltTaschenbuch Francis, Becky/Skelton, Christine (2011): Geschlecht und Bildungserfolg – Eine Analyse aus der Per spektive der Feminist Theory. In: Hadjar, Andreas (Hg.): Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 362-392 Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (2001a) (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspekti51
ven. Opladen: Leske + Budrich, S. 9-17 Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (2001b): Einleitung. In: dies. (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 9-17 Fuhr, Thomas/Schultheis, Klaudia (2006): Teil 1 – Grundlagen der Jungenforschung. In: Fuhr, Thomas/Schultheis, Klaudia/Strobel-Eisele, Gabriele (Hg.): Kinder – Geschlecht männlich – Pädagogische Jungenforschung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 12-71 GLADT e.V. (2011): Frauenräume und die Diskussion um Trans*-Offenheit. – URL: http://www.gladt.de/archiv/2011/safer_spaces_online.2.Auflage.pdf (Zugriff am 11. Januar 2013) Grote, Christoph/Jantz, Olaf (2003): »Meine ist die beste« - Qualitätskriterien in der Jungenarbeit. In: Grote, Christoph/Jantz, Olaf (Hg.): Perspektiven der Jungenarbeit – Konzepte und Impulse aus der Praxis. Opladen: Leske + Budrich, S. 89-104 Haritaworn, Jinthana (2005): Am Anfang war Audre Lorde – Weißsein und Machtvermeidung in der queeren Ursprungsgeschichte. In: feminia politica – Zeitschrif für feministische Politikwissenschaf (Berlin), Nr. 1/2005, 14. Jg., S. 23-36 Hartmann, Jutta (2001): Bewegungsräume zwischen Kritischer Theorie und Poststrukturalismus. In: Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 65-84 Hartmann, Jutta (2004): Vielfältige Lebensweisen transdiskursiv – Zur Relevanz dekonstruktiver Perspektiven in Pädagogik und Sozialer Arbeit. In: Dies. (Hg.): Grenzverwischungen – Vielfältige Lebensweisen im Gender-, Sexualitäts- und Generationendiskurs (Reihe Sozial- und Kulturwissenschafliche Studientexte, Band 9). Innsbruck: STUDIA Universtitätsverlag, 17-32 Hartmann, Jutta (2009): Heteronormativität – Pädagogische Implikationen eines macht- und identitätskritischen Konzeptes. In: Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. (Hg.): Betrifft Mädchen (Weinheim), Nr. 2/2009 (April 2009), 22. Jg., S. 52-58 Hartmann, Jutta (2012): Improvisationen im Rahmen des Zwangs – Gendertheoretische Herausforderungen der Schrifen Judith Butlers für pädagogische Theorie und Praxis. In: Balzer, Nicole/Ricken, Norbert (Hg.): Judith Butler – Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 149-178 Heinrichs, Gesa (2002): Geschlechtertransformationen – Überlegungen zu einer postfeministischen Bildungstheorie. In: Friedrichs, Werner/Sanders, Olaf (Hg.): Bildung, Transformation – Kultu52
relle und gesellschafliche Umbrüche aus bildungstheoretischer Perspektive. Bielefeld: transcript, S. 149-164 Heinrichs, Gesa/Pewny, Katharina (2006): Queere Bildung. In: Dzierzbicka, Agnieszka/Schirlbauer, Alfred (Hg.): Pädagogisches Glossar der Gegenwart – Von Autonomie bis Wissensmanagement. Wien: Löcker, S. 228-235 Hoffmann, Berno (1994): Geschlechterpädagogik – Plädoyer für eine neue Jungen- und Mädchenar beit. Münster: Votum Honegger, Claudia (1991): Die Ordnung der Geschlechter – Die Wissenschaf vom Menschen und vom Weib. Frankfurt: Campus Hornscheidt, Antje (2005): (Nicht)Benennungen – Critical Whiteness Studies und Linguistik. In: Eggers, Maureen M./Kilomba, Grada/Piesche, Peggy/Arndt, Susan (Hg.): Mythen, Masken und Subjekte – Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Münster: Unrast, S. 476-490 Howald, Jenny (2001): Ein Mädchen ist ein Mädchen ist kein Mädchen? Mögliche Bedeutungen von »Queer Theory« für die feministische Mädchenarbeit. In: Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 295-309 HVHS Alte Molkerei Frille (1989) (Hg.): Parteiliche Mädchenarbeit & Antisexistische Jungenarbeit – Abschlußbericht des Modellprojektes »Was Hänschen nicht lernt ... verändert Clara nimmer mehr«. Petershagen/Frille: Eigenverlag Karl, Holger (1996): Der ehrenhafe Abschied des Panzersoldaten – Grundlagen antisexistischer Jungenarbeit. In: Glücks, Elisabeth/Ottemeier-Glücks, Franz Gerd (Hg.): Geschlechtsbezogene Pädagogik – Ein Bildungskonzept zur Qualifizierung koedukativer Praxis durch parteiliche Mädchenarbeit und antisexistische Jungenarbeit. Münster: Votum, S. 133-154 Kegelklub (2012): Ergebnisse der Umfrage des Kegelklubs zur Genderdebatte in der Piratenpartei. – URL: http://kegelklub.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/120310-Kegelklub-Aus wertung.pdf (Zugriff am 21. Dezember 2012) KGL (2004): Unter´m Regenbogen – Lesben und Schwule in München. München: Eigenpublikation Klees, Renate/Marburger, Helga/Schumacher, Michaela (1989): Mädchenarbeit – Praxishandbuch für die Jugendarbeit Teil 1. München/Weinheim: Juventa Kreisky, Eva (2004): Geschlecht als politische und politikwissenschafliche Kategorie. In: Rosenberger, S. K./Sauer, B. (Hg.): Politikwissenschaf und Geschlecht. Wien: Facultas WUV 53
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. (2009) (Hg.): Betrifft Mädchen (Weinheim), Nr. 2 (April 2009), 22. Jg. Lenz, Ilse (2010): Intersektionalität – Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer Ungleichheit. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung – Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 158-165 Maikowski, Laura/Wesemüller, Ellen (2010): Mit Wertschätzung und Hartnäckigkeit – Eine Gruppendiskussion Friller Mädchen_- und Jungen_arbeiter_innen. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 290-307 MANEO (2009): Gewalterfahrungen von schwulen und bisexuellen Jugendlichen und Männern in Deutschland – Ergebnisse der MANEO-Umfrage. Berlin: Eigenpublikation Möhlke, Gabriele/Reiter, Gabi (1995): Feministische Mädchenarbeit – Gegen den Strom. Münster: Vortum Nagel, Björn (2010): Bilder von Mädchen – Zur Produktion von Weiblichkeit in der Jungen_arbeit. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 247-261 Ortner, Rosemarie (2007): Der Homo oeconomicus feministisch gebildet? Eine neoliberale Herausforderung für das Subjektverständnis feministischer Bildungstheorie. In: Borst, Eva/Casale, Rita (Hg.): Ökonomie der Geschlechter – Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaf, Band 3. Opladen/Farmington Hills: Barbara Budrich, S. 29-44 Plößer, Melanie (2005): Dekonstruktion ~ Feminismus ~ Pädagogik – Vermittlungsansätze zwischen Theorie und Praxis. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Plößer, Melanie (2009): I kissed a girl and I liked it? Queere Perspektiven für die feministische Mäd chenarbeit. In: Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. (Hg.): Betrifft Mädchen (Weinheim), Nr. 2/2009 (April 2009), 22. Jg., S. 59-63 Pohlkamp, Ines (2010): TransRäume – Mehr Platz für geschlechtliche Nonkonformität! In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis. Bielefeld: transcript, S. 38-58 Pohlkamp, Ines/Rauw, Regina (2009): Heteronormativitätskritische Mädchenarbeit – Reflexionen und Anregungen. In: Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. (Hg.): Betrifft 54
Mädchen (Weinheim), Nr. 2/2009 (April 2009), 22. Jg., S. 70-74 Pohlkamp, Ines/Rauw, Regina (2010): Mit Lust und Beunruhigung – Heteronormativitätskritik einbringen. In: Busche, Mart/Maikowski, Laura/Pohlkamp, Ines/Wesemüller, Ellen (Hg.): Feministische Mädchenarbeit weiterdenken – Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis . Bielefeld: transcript, S. 21-35 Rendtorff, Barbara (2006): Erziehung und Geschlecht – Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer Rendtorff, Barbara (2011): Geschlecht. In: Kade, Jochen/Helsper, Werner/Lüders, Christian/Egloff, Birte/Radtke, Frank-Olaf/Thole, Werner (Hg.): Pädagogisches Wissen – Erziehungswissenschaf in Grundbegriffen. Stuttgart: Kohlhammer, S. 70-76 Rendtorff, Barbara (2012): Biographie – Kurzvita. – URL: http://barbara-rendtorff.de/?s=02biographie (Zugriff am 07. Dezember 2012) S_He (2003): Performing the Gap – Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung. In: FelS – Für eine linke Strömung (Hg.): arranca! (Berlin), Nr. 28 (November 2003), o. Jg., S. 22-26 Schenk, Chris (2004): Über Frauenpolitik, Gender Mainstreaming und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung politischer Theorie und Praxis. In: Hertzfeld, Hella/Schäfgen, Katrin/Veth, Silke (Hg.): GeschlechterVerhältnisse – Analysen aus Wissenschaf, Politik und Praxis. Berlin: Karl Dietz, S. 209-220 Schmitz, Sigrid (2006): Geschlechtergrenzen – Geschlechtsentwicklung, Intersex und Transsex im Spannungsfeld zwischen biologischer Determination und kultureller Konstruktion. In: Ebeling, Smilla/Schmitz, Sigrid (Hg.): Geschlechterforschung und Naturwissenschafen – Einführung in ein komplexes Wechselspiel. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 33-56 Scholz, Sylka (2004): »Hegemoniale Männlichkeit« – Innovatives Konzept oder Leerformel? In: Hertzfeld, Hella/Schäfgen, Katrin/Veth, Silke (Hg.): GeschlechterVerhältnisse – Analysen aus Wissenschaf, Politik und Praxis. Berlin: Karl Dietz, S. 33-45 Smith, Anna Marie (2000): Wider die depolitisierenden Effekte des liberaldemokratischen Pluralismus – Die Rechte von Lesben und Schwulen jenseits der single-issue-Politik. In: Quaestio (Hg.): Queering Demokratie – Sexuelle Politiken. Berlin: Querverlag, S. 45-62 Steinert, Heinz (1989): Genau hinsehen, geduldig nachdenken und sich nicht dumm machen lassen. In: ders. (Hg.): Zur Kritik der empirischen Sozialforschung – Ein Methodengrundkurs. Frankfurt am Main: Eigenverlag Fachbereich Gesellschaftswissenschaften – Universität Frankfurt, S. 67 – 79 Stuve, Olaf (2001): »Queer Theory« und Jungenarbeit – Versuch einer paradoxen Verbindung. In: 55
Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 281-294 Stuve, Olaf (2004): In welche Gruppe wollt ihr gehen: in die Mädchen- oder Jungengruppe? – Gender grenzverwischungen in der Jugendarbeit. In: Hartmann, Jutta (Hg.): Grenzverwischungen – Vielfältige Lebensweisen im Gender-, Sexualitäts- und Generationendiskurs (Reihe Sozial- und Kulturwissenschafliche Studientexte, Band 9). Innsbruck: STUDIA Universtitätsverlag, 167177 Tanzberger, Renate (2006): Gender Mainstreaming. In: Dzierzbicka, Agnieszka/Schirlbauer, Alfred (Hg.): Pädagogisches Glossar der Gegenwart – Von Autonomie bis Wissensmanagement. Wien: Löcker, S. 128-134 Tervooren, Anja (2006): Im Spielraum von Geschlecht und Begehren – Ethnographie einer ausgehenden Kindheit. München/Weinheim: Juventa Tinkhauser, Petra (2009): Dekonstruktive Pädagogik – Paradigmenwechsel im Umgang mit Identitäten, Geschlechtern und Sexualitäten. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Universität Wien – Fakultät für Sozialwissenschaften – URL: http://othes.univie.ac.at/3672/1/2009-0123_0001947.pdf (Zugriff am 17. Januar 2013) Tinkhauser, Petra (2011): Queering Education – Dekonstruktive Pädagogik: Paradigmenwechsel im Umgang mit Identitäten, Geschlechtern und Sexualitäten. In: an.schläge – das feministische Monatsmagazin (Wien). Nr. 9/2011 (September 2011), o. Jg., S. 25-26 Treibel, Annette (2006): Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Tuider, Elisabeth (2004): Identitätskonstruktionen durchkreuzen – Queer – Hybridität – Differenz in der Sexualpädagogik. In: Hartmann, Jutta (Hg.): Grenzverwischungen – Vielfältige Lebensweisen im Gender-, Sexualitäts- und Generationendiskurs (Reihe Sozial- und Kulturwissenschafliche Studientexte, Band 9). Innsbruck: STUDIA Universtitätsverlag, S. 179-192 Tuider, Elisabeth/Huxel, Katrin (2010): Männlichkeit und die Übernahme von care-work im Migrationskontext. In: Moser, Vera/Pinhard, Inga (Hg.): Care – Wer sorgt für wen? Jahrbuch für Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaf. Opladen: Barbara Budrich, S. 87-98 Tunç, Michael (2006): Vaterschaf in der Migrationsgesellschaf im Wandel – Intersektionelle Männerforschung im Sinne Pierre Bourdieus. In: Promotionskolleg »Kinder und Kindheiten im Spannungsfeld gesellschaftlicher Modernisierung« (Hg.): Kinderwelten und institutionelle 56
Arrangements – Modernität von Kindheit. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 37-58 Voigt-Kehlenbeck, Corinna (2001): ... und was heißt das für die Praxis? Über den Übergang von einer geschlechterdifferenzierenden zu einer geschlechterreflektierenden Pädagogik. In: Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea/Tervooren, Anja (Hg.): Dekonstruktive Pädagogik – Erziehungswissenschafliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 237-254 von Felden, Heide (2003): Bildung und Geschlecht zwischen Moderne und Postmoderne. Opladen: Leske + Budrich Voß, Heinz-Jürgen (2011): Geschlecht – Wider die Natürlichkeit (Reihe theorie.org). Stuttgart: Schmetterling Wilchins, Riki (2006): Gender Theory – Eine Einführung. Berlin: Querverlag Woltersdorff, Volker (alias Logorrhöe, Lore) (2003): Queer Theory und Queer Politics. In: RosaLuxemburg-Stiftung (Hg.): UTOPIEkreativ (Berlin), Nr. 156 (Oktober 2003), o. Jg., S. 914923 Young, Iris Marion (1989): Humanismus, Gynozentrismus und feministische Politik. In: List, Elisabeth/Studer, Herlinde (Hg.): Denkverhältnisse – Feminismus und Kritik. Frankfurt: Suhrkamp, S. 37-65
57